Theater, Krise und Reform - Thomas Schmidts ambitionierte Studie zur Kritik des deutschen Theatersystems
Mammutaufgabe, machbar
von Dorothea Marcus
19. Januar 2016. Schwerfällige, unflexible Theaterbunker, unreformierbar, sagen die einen über das deutsche Stadttheatersystem. Leuchttürme der Kunst, weltweit einzigartig und beneidet, die anderen. Beide Aussagen erscheinen unvereinbar, und darin liegt der Kern der Krise: "Das Theater ist ein Ort, in dem sich Zustände konserviert haben, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, die das Theater abbildet", so Thomas Schmidt. Es sei eine Krise, die, wenn sie nicht aufgehalten wird, dazu führe, dass in 40 Jahren ein Drittel aller 141 deutschen Theater schließen. Noch beschleunigen wird sich das Theatersterben, wenn ab 2020 mit dem auslaufenden Solidarpakt II in Deutschland Sondermittel für den Osten entfallen – dabei befinden sich dort bereits jetzt die größten Theaterkrisen, man denke an Rostock, Dessau, Erfurt. Sicher hat auch unverantwortliche Kulturpolitik zu Raubbau und irreversibler Abwicklung geführt. Doch ein großer Teil der Krise liegt im System selbst.
 Auch im Westen wird die Lage zusehends dramatisch. Opernkarten, meint Thomas Schmidt, kosten 2040 mehr als doppelt so viel wie heute, dann sprießen in den "von den Städten verramschten Theatergebäuden die mit europäischen Mitteln geförderten Musicalhäuser aus dem Boden und bieten Einheitskost". Es treffe meist kleine und mittlere Theater – die großen seien durch hohe feuilletonistische Aufmerksamkeit weitgehend geschützt. Dabei wirtschaften sie bei weitem am Uneffizientesten. Im ach so strukturschwachen Osten leistet man sich etwa zwei große repräsentative Opernhäuser – Leipzig und Erfurt, während man zum Beispiel das Schauspiel sowie das Kinder- und Jugendtheater Erfurt 2003 geschlossen hat.
Auch im Westen wird die Lage zusehends dramatisch. Opernkarten, meint Thomas Schmidt, kosten 2040 mehr als doppelt so viel wie heute, dann sprießen in den "von den Städten verramschten Theatergebäuden die mit europäischen Mitteln geförderten Musicalhäuser aus dem Boden und bieten Einheitskost". Es treffe meist kleine und mittlere Theater – die großen seien durch hohe feuilletonistische Aufmerksamkeit weitgehend geschützt. Dabei wirtschaften sie bei weitem am Uneffizientesten. Im ach so strukturschwachen Osten leistet man sich etwa zwei große repräsentative Opernhäuser – Leipzig und Erfurt, während man zum Beispiel das Schauspiel sowie das Kinder- und Jugendtheater Erfurt 2003 geschlossen hat.
Man soll keine Neiddebatte führen? Das fällt schwer, wenn man sich vor Augen führt, dass etwa in Leipzig eine Opernvorstellung rund 200.000 Euro pro Abend kostet. Davon hätte das Kindertheater in Erfurt einige Zeit weiterleben können. Furchtlos benennt Schmidt in seinem Buch "Theater, Krise und Reform" die fast obszöne Unverhältnismäßigkeit zwischen großen und kleinen Häusern: "Warum finanzieren Kommunen solche Luxusproduktionen, während sie an anderer Stelle heftige Kürzungen im kulturellen und soziokulturellen Bereich veranlassen?" Wie kann es sein, dass in Opernhäusern der Metropolen eine einzelne Vorstellung im Durchschnitt 250.000 Euro kostet – während ein Abend in einem Landestheater wie Anklam, Parchim oder Konstanz etwa 30mal günstiger ist und bis zu viermal mehr Menschen erreicht? Schmidt macht auch gleich einen Vorschlag: Von allen Produktionen, die über 50.000 Euro Kosten pro Vorstellung hinausgehen, könnten zehn Prozent abgezogen und umverteilt werden. Das ist nur ein Beispiel von konstruktiven und pragmatischen Klein-Reformen, die Schmidt in seinem Buch zu etwas fügt, was im Ganzen einer Theaterrevolution gleichen würde.
Krisendiagnose
Seine Krisendiagnose ist zunächst aber niederschmetternd: Während die Zuschauerzahlen stetig abnehmen, produzieren die Theater mit immer weniger Geld immer mehr und bleiben dabei in alten Strukturen erstarrt wie eh und je. Intendanten regierten mit absurd absolutistischer Herrschergewalt, mittlere Stadttheater zehrten sich an Tariferhöhungen auf, Kulturpolitiker agierten kopflos und Theaterkünstler rieben sich zunehmend auf.
Schmidt muss es wissen, von 2003 bis 2013 war er in der Leitung, ab 2013 Interimsintendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Dort setzte er mit Stephan Märki das sogenannte "Weimarer Modell" durch – ein erster Reformansatz, der im Wesentlichen daraus bestand, ein Hausvertrags-Tarifsystem zu verhandeln. Nicht ansatzweise ausreichend, sagt er selbst. Heute ist Schmidt Professor und Direktor des Studiengangs Theater und Orchestermanagement in Frankfurt/Main und beschäftigt sich täglich mit der Organisation von Kultur. Sein Buch liest sich zwar immer wieder wie ein Lehrbuch für professionelle Unternehmensführung, aber stellenweise auch spannend wie ein Krimi. Brutal und furchtlos listet er die perversen Auswüchse eines maroden Systems auf, der veralteten, autoritären Hierarchie-Struktur und schreckt dabei eben auch nicht vor Tabus zurück, indem er etwa das in Deutschland sakrosankte Prinzip des Repertoire-Betriebs in Frage stellt, ein "bald nicht mehr bezahlbarer Luxus", das die Kosten extrem in die Höhe treibe.
Der selbst gemachte Druck der Maschine Theater
Die Zuschauerrückgänge bewirkten, dass sich Theater zunehmend gezwungen fühlen, immer mehr zu produzieren. Mittlerweile haue jedes mittlere Theater in zehn Spielzeitmonaten bis zu 23 Produktionen heraus. Wurden 1995/96 von ca. 42.000 Theatermitarbeitern 57.000 Veranstaltungen gestemmt, waren es 2013/14 schon 74.000 Veranstaltungen mit nur noch 39.000 Mitarbeitern. Keine Zeit mehr zur Reflexion und wachsender Raubbau am künstlerischen Personal sind die Folgen. Kein Wunder, dass das neu gegründete Ensemble-Netzwerk immer stärker wird.
 Autor Thomas SchmidtVor allen Dingen aber tut Schmidt in seinem Buch, was etwa die Autoren des "Kulturinfarkts" einst versäumten: pragmatisch und konstruktiv stellt er acht Reformstränge und einen 40-Punkte-Plan vor, um das Theatersystem realistisch zu reformieren.
Autor Thomas SchmidtVor allen Dingen aber tut Schmidt in seinem Buch, was etwa die Autoren des "Kulturinfarkts" einst versäumten: pragmatisch und konstruktiv stellt er acht Reformstränge und einen 40-Punkte-Plan vor, um das Theatersystem realistisch zu reformieren.
Einer der Punkte ist sein Vorschlag, kollektiv aus dem öffentlichen Dienst auszutreten, um das ungerechte Mehrklassensystem an Theatern zu beenden. Ein weiterer: Der Abbau der grotesken Allmacht einzelner Intendanten, zugunsten von Team-Modellen und mehr Mitspracherechten des Ensembles. In einem Direktorium etwa könnte immer nur ein Leitungsmitglied ausscheiden, auch würde nicht stets aufs Neue ein Großteil des künstlerischen Ensembles ausgetauscht. Ein Mixed-Stagione-Prinzip, indem manche Produktionen länger am Stück gespielt werden statt des kostenintensiven Repertoire-Wahnsinns. Eine Organisation in der Rechtsform von Stiftungen. Verbindliche Honorarsysteme, um zunehmend explodierende Star-Gagen zu beschränken. Eine klügere Zusammenarbeit mit der Freien Szene, um ihr Innovationspotential zu nutzen. Vor allem aber plädiert Schmidt dafür, eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln, die dann das Vehikel für Reformen wäre, inklusive einer Eingangsprüfung der Theaterleitung sowie eines Leitbilds, auf das sich alle Theatermitarbeiter verständigen können: gut für Motivation und Atmosphäre am Haus.
Kunstfremde Begrifflichkeit
Schmidt scheut sich nicht, mit Begriffen aus der modernen Unternehmenspraxis zu operieren, das verlangsamt die Lektüre zuweilen, er empfiehlt "Change Management" und "Matrixorganisation" und stellt beide Prinzipien seitenlang vor – insgesamt eher kunstfremd wirkende Begriffe. Am Ende des über 400 Seiten langen Buches bleibt dennoch der Eindruck: Die grundsätzliche Reform des deutschen Stadttheatersystems ist eine Mammutaufgabe, die in kleinen Schritten machbar und unbedingt notwendig erscheint. Man kann da sicher Details kritisieren. Etwa, dass Schmidt eine genaue Analyse des Zuschauergeschmacks mit demographischer Analyse empfiehlt – und der Kunst ihre Kraft als widerständiges Medium gewissermaßen abspricht. Oder dass seine Argumente sich oft wiederholen, weil die einzelnen Reformbereiche ineinandergreifen. Auch wirkt seine Begrifflichkeit zuweilen äußerst durchökonomisiert. Hoch anrechnen muss man Schmidt aber, dass er seit langem schwelende und stets unlösbar erscheinende Probleme bündig zusammenfasst und seine Reformen konstruktiv und unkonventionell erscheinen, auch in Bereichen, die tabubesetzt sind. Es bleibt der Eindruck: Das Buch war überfällig. Es bietet eine konkrete Anleitung zur Erneuerung eines Systems, das sonst unwiderruflich todgeweiht ist.
Theater, Krise und Reform. Eine Kritik des deutschen Theatersystems
von Thomas Schmidt
Springer Fachmedien Wiesbaden 2017, 465 Seiten, 69,99 Euro
Mehr zur Debatte um das Theatersystem im deutschsprachigen Raum: Stephanie Gräve und Jonas Zipf fordern in ihrem Beitrag zur Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de eine Reform der Leitungsstruktur an Theatern aus dem Geiste der Mitbestimmung.
mehr bücher
meldungen >
- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein
- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt
- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral
- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"
- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben
- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant
neueste kommentare >
-
Rücktritt Würzburg Nachtrag
-
Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin
-
Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt
-
Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich
-
Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin
-
Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?
-
Landesbühnentage Kleinmut
-
Kolumne Wolf Autorenvereinigungen
-
Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich
-
Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg



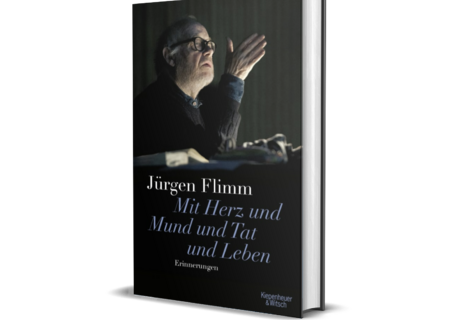









haben Sie das buch denn gelesen, oder mal reingeschaut? ich würde es sehr gerne mit Ihnen diskutieren, falls Sie für reformfragen überhaupt einen nerv haben. soweit ich Ihre agenda und Ihre betriebswirtschaftlichen modelle für Rostock und Halle verstehe, wird Rostock aufgrund Ihrer konzepte seine schauspiel-, seine tanz- und seine kinder- und jugend-theatersparte verlieren. ein unglaublicher verlust für dieses so wichtige theater im Nordosten. in halle, wiederum, werden Sie als geschäftsführer der fusionierten theater und orchester der chef-abwickler von mindestens 40 orchester- und weiteren 40 stellen in den theatern sein - so die planung dort. die "Widerständigkeit der Kunst" wurde auf dem altar der fusion geopfert, und die verschmelzung der beiden orchester und die subordination der theater, wiederum, fordert irreversible stellen und zerstört künstlerische substanz, die nie wiederkommen werden - dessen sind sich offensichtlich nicht alle Handelnden bewusst. alles in allem, keine wirklich gute bilanz. ich nenne das neo-liberales management, und genau dagegen setze ich meine vorschläge.
lesen Sie doch bitte mein buch, und ich bin gerne bereit aus Ihrem Saulus einen Paulus zu machen, denn wir brauchen jede hand und jeden kopf um die anstehenden Reformen umzusetzen.
Und Sie müssen sich nicht sorgen, der kunst spreche ich als widerständigem medium einer "imaginierten realität" nichts ab, ganz im gegenteil - aber das wissen Sie ja eigentlich aus meiner Weimarer Zeit. (das luhmann-zitat einer "produktion für beobachtung" kenne ich nicht, luhmann unterscheidet autopoetische produktion und beobachtung sehr strikt und schiebt hier das konzept der "Operation" dazwischen; aber das hat mit unserem diskussionsgegenstand wenig zu tun, und ich bin ohnehin ein verfechter der kritischen theorie). was ich aber einfordere, ist stärker darauf zu achten, wie sich zuschauergruppen tatsächlich demografisch zusammen setzen, damit künstlerische Prozesse sich wieder besser mit der suche nach dem eigenen und dem zukünftigen publikum verknüpfen, damit die theater nicht eines tages vor leeren sälen spielen. zwischen 1975 und heute hat sich die zahl der zuschauer je vorstellung von 575 auf 305 zuschauer je vorstellung quasi halbiert. und der trend geht weiter.
ich bin derweil auf die imaginierte Realität der produktionen in halle gespannt, denen Sie ja nun vorstehen. und gespannt bin ich, ob Sie das Hallenser Leitungsmodell nun endlich reformieren und die künstlerischen leiter der häuser an der gesamtleitung beteiligen! das wäre ein richtiger schritt! nur mut!
You are not alone! mit den besten grüßen dorthin, thomas schmidt
Es tut mir oft leid, dass freie Produktionen immer so schnell verschwinden.
Eine reine Verschiebung der Machtverhältnisse auf ein Ensemble und sein mehrköpfiges, von ihm ernanntes Direktorium löst die Probleme der Kunstproduktion ebenfalls nicht, denn ein Direktorium von "Schauspielers Gnaden" ist ebenso in seinen künstlerischen Entscheidungen zu eindeutig in Abhängigkeiten zum Ensemble verstrickt, vor allem, wenn es hauptsächlich darum geht lediglich langfristige Künstlerverträge durchzusetzen, denn dies sind im Kern Zielsetzungen zum Anstellungsverhältnis und wiederum nicht voranging Ziele der Kunst.
Schmidts Herangehensweise ist da deutlich radikaler, weil er sich letztendlich einen Austritt aus dem städtischen Angestelltenverhältnis wünscht und eine Gesellschaftsform im Rahmen einer Stiftung. Da kann man von einem ernsthaften Wunsch zu einer Reform sprechen.
Wie Rosinski aber zurecht bemerkt, betrachtet man einmal die Produktdefinition bei Schmidt, wird es schon erheblich schwieriger, wenn er dem Produkt "Theateraufführung" eines seiner wichtigsten Merkmale, eben das "Widerständige" abspricht oder aber es für obsolet erklärt.
Hier wird deutlich, dass unter dem Oberbegriff "Stadttheater" sehr unterschiedliche Produkte erarbeitet werden. Da ist einmal das sogenannte "Luxusprodukt", mit einem abendlichen Aufwand von bis zu 250 000 Euro. Und wiederum dagegen die Schauspielproduktion mit eventuell nur einem Bruchteil der Kosten pro Aufführung, von vielleicht gerade einmal 10 000 Euro.
Alles hängt davon ab, welchem Bereich man die Produkte zuordnet. Es wäre zu einfach, die Oper einfach nur als ein "Genussmittel" zu verdammen, und ihr, auf Grund der hohen Kosten, jede "Widerständigkeit" abzusprechen. Ebenso wäre es unsinnig jeder Schauspielproduktion, nur weil sie günstiger daher kommt, eine "revolutionäre" Energie zu zusprechen.
Und doch spricht vieles dafür, die jeweiligen Reformen vom Produkt her zu definieren, was größtenteils überhaupt nicht geschieht.
Ginge man einmal davon aus, dass es sich tatsächlich um eine künstlerische "Genussmittelproduktion" handelte, die keinerlei "Widerständiges" aufzuweisen hätte, dann dürften die Reformen wohl weit aus radikaler Ausfallen, als vielen lieb sein könnte.
Es fehlen oft die ganz einfachen Schritte in der Analyse: Welches Produkt möchte ich herstellen? (Eine genaue Beschreibung wäre vorteilhaft.) Wie sieht die Produktionsplanung aus? Wie die eigentliche Produktion? Und kann die von einem herkömmlichen Stadttheater in der heutigen Form überhaupt noch geleistet werden? Ohne die schon bekannten enormen künstlerischen Einbußen.
leider war ich zu dieser Zeit noch ziemlich klein - aber ich würde mich, da ich ja bekanntermaßen auf Originalität und Neuerfindung gar nicht so furchtbar viel Wert lege, sehr gern einmal mit Ihnen darüber unterhalten. Kommen Sie doch am Sonntag zur Akademie der Künste, oder lassen Sie sich meine Mailadresse geben. Ich könnte dann Ihren Erfahrungsschatz ins Ensemble-Netzwerk tragen. Liebe Grüße, Stephanie Gräve
das wollen wir auch nicht. reformen sollen keine aufgabe von marketingberatern, sondern von den künstlern und klugen köpfen selbst sein. dass sich reformen in kultur-institutionen an die umfeldbedingungen koppeln oder nicht entkoppeln lassen ist eine richtige einschätzung bzw. analyse, aber welche katastrophale schlussfolgerung müssten wir dann heute ziehen.
deshalb doch besser: reformen und gutes theater machen. sehr bald, sogar!
es grüßt Sie herzlich, thomas schmidt
sagen Sie, haben Sie - wenn Sie mir diese Frage erkauben wollen - im Verlaufe der Lektüre Seiten gefunden, auf denen der Autor seine Methoden der Datenerhebung erläutert? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir in diesem Punkt weiterhelfen könnten, ich finde irgendwie nichts.
Vielen Dank!
Beste Grüße,
H.L.
Sehr geehrter Herr Lewy,
die Datenerhebung erfolgte durch die systematische Digitalisierung der Theaterstatistiken des deutschen Bühnenvereins von 1991, also dem ersten Jahr, in dem die Theater der ehem. DDR aufgenommen worden waren, bis einschließlich 2013|14. Die Statistik 14|15 kam sehr spät und konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Man muss dazu sagen, dass der Deutsche Bühnenverein eine sehr systematische und kontinuierliche Erhebung aller wichtigen Daten der öffentlichen Theater vornimmt, so dass eine eigenständige Datenerhebung nicht notwendig war. Im Text habe ich durchgängig auf diese Quellen hingewiesen; sie finden meine Anmerkungen in den Fußnoten.
Die Daten wurden digitalisiert, und ich habe fünf Indikatoren entwickelt, um eine quantitative Analyse vorzunehmen, die im Laufe des Textes schließlich ausgewertet und verglichen wurden, und die durch eine qualitative Analyse ergänzt worden ist. Dies habe ich länglich im Kapitel 2 ausgeführt.
Hinzu kam die Analyse von allen relevanten Publikationen zum deutschen Theater in diesem Zeitraum, verschiedener von den Theatern publizierter Zahlen, sowie die Auswertung zahlreicher Interviews und Gespräche, die zwischen 2000 und 2015 geführt worden sind. Ergänzt wurde dies durch Exkurse am Beispiel des Nationaltheaters Weimar o. a. Theater, und spezifischer Fallbeispiele, wie der Entwicklung der Theaterlandschaft Mecklenburg Vorpommern, und hier die Auswertung der Metrum-Studie und deren Vorschläge, sowie aller Materialien sowie veröffentlichten Konzepte zum Volkstheater Rostock - so dass ich insgesamt nicht nur auf eine sehr breite, durch den Bühnenverein verifizierte Datenbasis zurückgreifen, sondern dies durch punktuelle Exkurse ergänzen konnte.
Im Text habe ich immer wieder auf diese Quellen hingewiesen.
# 12
lieber herr steckel,
das soll heißen, dass sich die theater ab einem bestimmten punkt von den politischen rahmenbedingungen entkoppeln und ein programm machen müssen, dass sich emanzipiert, und auf misstände hinweist, reformen anregt, etcetera. ich bin der meinung, dass theater ab einem bestimmten punkt immer auch politisch sein muss - im sinne brechts. aber ich denke, diese meinung teilen hier fast alle.
a propos, Sie sind nicht auf meinen vorschlag eingegangen: ich wollte Sie gerne noch einmal zu Ihren erfahrungen mit mitbestimmungsmodellen in den 70er Jahren befragen. Ihr wissen ist wichtig für uns alle. Ich würde mich sehr freuen.
vielen Dank, dass Sie für Dorothea Marcus antworten.
Und schön, dass wir ins Gespräch kommen.
Interessiert hat mich Ihr Buch sehr und ich habe es mit großer Begeisterung gelesen.
Nehmen sie beispielsweise die Stadt Schönebeck/Elbe, die Geburtsstadt des Verfassers von "Spur der Steine", Vorlage für Heiner Müllers "Der Bau". Dort gab es so ein Haus, das unter dem Label "Kreiskulturhaus" auch Schauspieltruppen ein Dach bot, die für Kinder - Schülergruppen gingen da hin - etwa "Der Drache" von Jewgeni Schwarz spielten. Sagen wir, Gastspiele können interessant sein. Das Haus stand irgendwann leer, wurde abgerissen. In unmittelbarer Umgebung gibt es ein Theater in Bernburg, aufwändig (zuweilen durchaus unglücklich) renoviert (EU-Strukturfondsförderung - ich befürworte den Prozess der Europäischen Inegration sehr), altes Hoftheater. Da sah ich vor ein paar Jahren ein Gastspiel der Landesbühne Sachsen, so einen Musicalverschnitt von "Some like it hot" - sehr angebotsorientiert (99% weibliche Besucher), also an der dramatischen Situation in der Region vorbei gespielt. Sagen wir, Gastspiele können uninteressant sein.
Gewiss mögen Sie mir zustimmen, dass es in dieser geographischen Region das Phänomen des demographischen Wandels gibt.
Es ist mir klar geworden, dass Sie versuchen den quantitaven Aspekt (dazu zähle ich auch: Abrißzahlen, Anzahl der Gastspiele etc.) zu erfassen. Vielleicht suchte ich in den genannten Statistiken die Abrißzahlen deshalb vergeblich. Wissen Sie zufällig, warum die Statistiken des Deutschen Bühnevereins 1991 beginnen? Ich stelle diese Frage, weil ich mir wünsche, wir könnten im Gespräch bleiben. Überzeugt haben mich Ihre Erläuterungen zu den Methoden der Datenerhebung noch nicht. Aber Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie qualitative Überlegungen noch liefern werden. Darüber bin ich begeistert. Natürlich möchte ich die Kommentarspalte hier jetzt nicht übergebührlich beanspruchen und anderen den Platz rauben. Deshalb schließe ich wohlwollend und interessiert diesen offenen Brief
mit herzlichem Gruß,
H.L.