Theater und Sexismus - Bestandsaufnahme einer vernachlässigten Diskussion
Frauen, seid geduldig!?
von Leopold Lippert
Berlin, 16. Juli 2015. Birgit Stögers lustloses, mechanisches Gerammel platzt mitten in die schönste Theaterutopie: In Community, Yael Ronens verspielter Fantasie einer hippiesken Bühnenkommune mit Fahrradstrampelstrom und Kübeldusche (Schauspielhaus Graz, Saison 14/15), wurde gerade noch das Gemeinschaftliche des Theaters mit allerlei philosophischer Unterfütterung beschworen, als Stöger lakonisch befindet, so toll sei das alles auch wieder nicht auf den Stadttheaterbühnen. Und dann spielt sie eben die zweifelhaften Höhepunkte ihres bisherigen bildungskanonischen Rollenlebens nach, in Düsseldorf, Zürich und Graz: Vergewaltigung folgt auf Vergewaltigung, und dank ideenreicher (männlicher) Regisseure darf auch dann drauflosvergewaltigt werden, wenn der Akt im Text bloß angedeutet wird.
Opfer, Tauschobjekt oder Randerscheinung: die Rolle der Frau im Theater
Als Stöger verschwitzt abbricht, beginnt Katharina Klar zu maulen. Vergewaltigt wurde sie zwar noch nicht auf der Bühne, sagt sie, dafür hat sie viele Stunden ihres Lebens damit verbracht, stumm am Bühnenrand rumzustehen und bewundernd dreinzuschauen, während ihre männlichen Kollegen die Handlung vorantreiben. Frauen, befindet Klar, werden am Theater "gnadenlos zugequatscht" und müssen außerdem "wahnsinnig geduldig" sein, weil es meistens ziemlich lange dauert, bis sie überhaupt einmal zu Wort kommen.
 Yael Ronens Grazer Theater-"Community"
Yael Ronens Grazer Theater-"Community"
© Lupi SpumaRonen nutzt diese Szenen, um mit der romantischen Verklärung des Theaters als Ort einer idealisierten Öffentlichkeit zu brechen. Denn während Männer auf der Bühne über das Menschsein streiten dürfen, sind Frauen meistens Opfer, Tauschobjekte, oder einfach Randerscheinungen. In der "Community" des Theaters, so erzählen Stöger und Klar, geht es immer noch ziemlich sexistisch zu.
Die Bedingungen sexistischer Bedeutungsproduktion
Die Reflexion darüber hält sich allerdings in Grenzen. Während rassistische Praktiken und ihre ästhetisierte Reproduktion im deutschen Theater zunehmend problematisiert und auch angegriffen werden, wird Sexismus auf der Bühne nicht gerade breitenwirksam diskutiert (ganz zu schweigen von den Verschränkungen von rassistischen und sexistischen Abbildungslogiken). Dabei wäre eine differenzierte Auseinandersetzung höchst an der Zeit, nicht nur, um ein stärkeres Bewusstsein für die Geschlechtlichkeit von Machtverhältnissen zu schaffen, sondern auch, um besser gegensteuern zu können (etwa von Seiten des Publikums, der Kritik, aber auch anderer Theatermacher*innen), wenn Inszenierungen den immer schon voyeuristischen Zuschauer*innenblick dahingehend lenken, dass Frauen auf der Bühne zu bloßen Schauobjekten ohne Handlungsmacht degradiert werden.
Was dabei als Sexismus zu problematisieren ist, ist gar nicht immer so einfach. Denn Theater hat sowohl eine ästhetische als auch eine öffentliche, soziale Dimension. Und während ästhetische Zeichen zitierend, verfremdend, ironisch, oder ausstellend gemeint sein können, sind sie nur in konkreten öffentlichen Kontexten (dem deutschsprachigen Stadttheater etwa, oder der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft) lesbar, wo das alles auch ganz anders verstanden werden kann. Die Bedeutung von Theater (und auch sein Sexismus) entsteht dabei erst im Zusammenspiel von Ästhetik und sozialer Praxis, das impliziert einen Kampf um die Deutungshoheit. Deswegen sind ein Sexismus-TÜV oder gar eine Sexismus-Triggerwarnung wohl wenig zielführend: Man wird nie alle Deutungskontexte abdecken können. Nichtsdestotrotz ist es immer notwendig, auf einer strukturellen Ebene über potentiell sexistische Zeichen auf der Bühne zu reflektieren, um den Bedeutungshorizont des Theaters egalitärer und demokratischer gestalten zu können.
 Frauen und Mann in Unterwäsche: Frank Castorfs "Baal" © Matthias Horn
Frauen und Mann in Unterwäsche: Frank Castorfs "Baal" © Matthias Horn
Nicht die Nacktheit ist das Problem
Einerseits können sexistische Zeichen dem Körper auf der Bühne eingeschrieben werden. Die zentrale Frage dabei ist, inwieweit Inszenierungen den sogenannten "male gaze" auf die Körper der Schauspieler*innen herausfordern. Die Rede vom "male gaze" stammt aus der feministischen Filmtheorie, wo der Begriff verwendet wird, um aufzuzeigen, wie im Mainstream-Kino durch die Kameraführung der Zuschauer*innenblick so konstruiert wird, dass er einem männlich heterosexuellen Begehrensblick entspricht, und damit Frauen bloß als Objekte dieses Begehrens positioniert. Auch wenn es am Theater keine Fokussierung durch die Kameralinse gibt: Frauen als plumpe (und oft auch noch nackt gemachte) Begehrensobjekte gibt es zuhauf.
Wenn sich also, wie vor kurzem auf nachtkritik anlässlich Frank Castorfs Baal-Inszenierung (Residenztheater München, Saison 14/15), Sophie Diesselhorst darüber beschwert, dass die "Castorf-Chicks" immer halbnackt mit Glitzer- und Spitzenschlüpfern rumlaufen müssen, dann geht es weniger um den konkreten Textilanteil als um die Konstruktion eines männlich-heterosexuell begehrenden Blicks auf eben diese "Chicks". Das Gegenargument, auch Männer müssten sich bei Castorf ausziehen (in den Kommentarspalten entspann sich eine etwas skurrile Diskussion über Aurel Mantheis "Schmerbauch"), führt also an der Sache vorbei, weil ja nicht Nacktheit an sich das Problem ist, sondern der durch die Inszenierung begehrend darauf gelenkte Blick.
Nackte Frauen tanzen den "male gaze" weg: "Untitled Feminist Show" von Young Jean Lee
 Schöne und hässliche Frauen: "Das blinde
Schöne und hässliche Frauen: "Das blinde
Geschehen" © Reinhard Werner
Dabei könnte man Castorf mit gutem Willen ja noch Altherren-Schmeichelei unterstellen, sollen seine "Chicks" ja irgendwie "sexy" sein. Maria Happel hingegen wird am Wiener Burgtheater in schöner Regelmäßigkeit als bloßer fetter Körper ausgestellt, ein fröhlich wabbelnder Lachzwerg, den schon lange niemand mehr begehrt. In Das blinde Geschehen etwa, Matthias Hartmanns Uraufführung eines Botho Strauß-Stücks (Burgtheater Wien, Saison 11/12), muss sie sich erst in einer (zu kleinen) Schubkarre herumfahren lassen, dann ihren Körper überdimensioniert an die Wand projiziert sehen, und sich schließlich zu vergnügtem Gelächter des Publikums als "monströser Batzen Weib" bezeichnen lassen (dabei ist ihre Rolle einfach nur "Journalistin"). Happels Körper wird dem männlich heterosexuellen Blick geradezu ausgeliefert, dessen Begehren sich hier in negativer Form als Ekel oder Belustigung manifestiert.
Dabei könnte man mit dem "male gaze" sehr viel differenzierter umgehen. In Young Jean Lees Untitled Feminist Show (2012 beim Steirischen Herbst Graz, 2013 im HAU Berlin und auf Kampnagel Hamburg) sind zwar ausschließlich nackte weibliche Körper zu sehen, aber der Blick darauf wird völlig anders konstruiert als bei Castorf oder Hartmann. Hier geht es weniger um das Begehren nach "Chicks"/den Ekel vor Monstern, sondern schlicht darum, dass sich Frauen in ihren lustvoll tanzenden Körpern ziemlich wohl fühlen können – ganz ohne Männer, die ihnen dabei implizit zuschauen. Mehr noch: Zur Halbzeit geht im Saal unvermittelt das Licht an, und Young Jean Lees Performerinnen stellen sich demonstrativ an die Rampe. Sie zwingen das Publikum, sich selbst beim Zuschauen zu beobachten. Der begehrende Blick auf nackte Frauen wird so explizit zum Thema gemacht. Und das Publikum kann sich nicht länger in jener Sicherheit wiegen, die mit der voyeuristischen Unsichtbarkeit einhergeht.
Elfriede Jelineks "FaustIn and Out": Sekundärdrama zur Gewissensberuhigung?
 Jugendfrei retuschiertes Pressefoto von der
Jugendfrei retuschiertes Pressefoto von der
"Untitled Feminist Show" © Blaine Davis Auf der anderen Seite kann Sexismus auf der Bühne auch über die Zeichenhaftigkeit der Sprache transportiert werden, und über die oft kanonisierten Stücknarrative, die Frauen(figuren) in stereotype (und meist unbedeutende) Rollen drängen. Von den formelhaft greinenden Frauen der Antike über die unschuldigen aber auch hilflosen Opfer in "Hamlet" oder "Faust" bis zu den Hausfrau / Vamp-Doppelungen in "Tod eines Handlungsreisenden" oder "Endstation Sehnsucht" reicht hier das Spektrum. In der kanonischen Theatergeschichte sind eigenmächtig handelnde Frauen eher die Ausnahme als die Regel, und wenn sie doch einmal zu Akteurinnen gemacht werden, dann eher durch Inszenierungen, die gegen den Text arbeiten.
Bei soviel Klischee im Theaterkanon ist etwa Elfriede Jelineks "FaustIn and Out" der in letzter Zeit am breitesten rezipierte Versuch, gegenzusteuern: Ihr "Sekundärdrama" (das nur in Kombination mit Goethes "Faust" gespielt werden darf) problematisiert die sexuelle Gewalt des Faust-Gretchen-Verhältnisses und imaginiert Faust als Vorfahren des österreichischen Sexualstraftäters Josef Fritzl, der seine Tochter zwei Jahrzehnte lang in einen Keller sperrte und mit ihr mehrere Kinder zeugte. Trotz dieser feministischen Überschreibung ist die Kombination von Primär- und Sekundärtext am Münchner Residenztheater in der Saison 13/14 bezeichnend: Während Jelineks Stück ja wohl eigentlich auf den Spielplan gehievt wurde, um mit den Stereotypen zu brechen (in München inszenierte es Johan Simons, hier die Nachtkritik), schöpft die Ko-Produktion, Martin Kušejs kraftmeiernder "Faust I", weiter aus dem Topf der sexistischen Frauenbilder: Sein Gretchen ist, so schreibt Isabel Winklbauer in ihrer Nachtkritik, "unschuldig wie ein taufrisches Gänseblümchen" – eine damsel in distress also, die von den aufgeklärten Herren erst begehrt und dann fallengelassen, in jedem Fall aber als bloßes Objekt benutzt wird. Ist Jelineks "FaustIn" also auch insofern nur sekundär, als sie ein primär schlechtes Gewissen beruhigen soll?
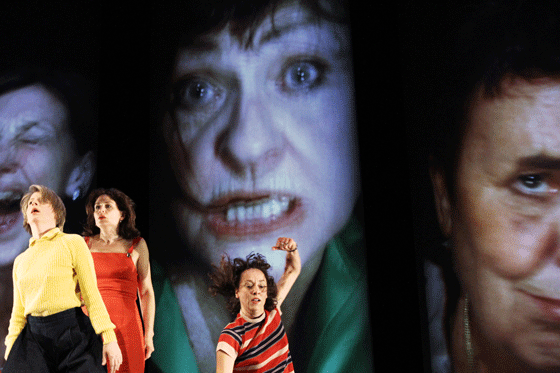 She She Pop vor Mütterprojektionen: "Frühlingsopfer" © Dorothea Tuch
She She Pop vor Mütterprojektionen: "Frühlingsopfer" © Dorothea Tuch
Wie She She Pop das traditionelle Bild der ohnmächtigen Frau reproduzieren
Dass sexistische Abbildungslogiken kein ausschließliches Problem der (bisher angeführten) männlichen Regiemacker sind, sondern auch in der freien Szene – wenn auch in abgeschwächter Form – bedient werden, zeigt sich schließlich am höchst unterschiedlichen Umgang von She She Pop mit ihren Vätern (Testament, Premiere 2010 im HAU) und Müttern (Frühlingsopfer, Premiere 2014 im HAU). Dabei ist gar nicht so sehr die thematische Rahmung problematisch, die die Mütter schon von vornherein als "Opfer" begreift – das könnte ja tatsächlich dem biographisch-dokumentarischen Zugriff geschuldet sein, und damit mehr über die soziale Herkunft der Performer*innen aussagen als über ihre künstlerische Arbeit. Was vielmehr überrascht, ist, dass die Mütter im Gegensatz zu den Vätern nicht auf der Bühne stehen, und stattdessen bloß als überdimensionierte Projektionen mit den Performer*innen interagieren.
Während sich ein zentraler Konflikt von "Testament" um das Mitspracherecht und die Einflussnahme der Väter auf ihre eigene Repräsentation auf der Bühne dreht, wird diese Problematik bei den Müttern einfach ausgespart. Und während "Testament" zeigt, wie Väter und Kinder den Kampf um die Deutungshoheit über ihre Figuren offen austragen, bleiben die Mütter in "Frühlingsopfer" bloße Textlieferantinnen, deren "Auftritte" auf der Bühne der vollständigen Kontrolle der Performer*innen unterliegen. She She Pop reproduzieren damit das Bild der ohnmächtigen Frau, der keine Handlungsmacht zugestanden werden kann. Von vier beweglichen Leinwänden auf ihre Kinder herabschauend sind diese Mütter auch 2014 gar nicht so anders als die Linda Lomans der 1940er Jahre – sie bleiben simple Projektionsflächen und als solche sind sie, um es mit Katharina Klar zu sagen, tatsächlich wahnsinnig geduldig.
 Leopold Lippert, Jahrgang 1985, studierte Anglistik und Amerikanistik in Wien und arbeitete am Institut für Amerikanistik an der Uni Graz. Er lebt derzeit in Berlin und ist Autor von nachtkritik.de.
Leopold Lippert, Jahrgang 1985, studierte Anglistik und Amerikanistik in Wien und arbeitete am Institut für Amerikanistik an der Uni Graz. Er lebt derzeit in Berlin und ist Autor von nachtkritik.de.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.













