PeterLicht: Ja okay, aber - Der Indiepop-Dichter und Molière-Adept erzählt in seinem neuen Roman vom Leben im Coworking-Space
Zeichensalat der Gegenwart
27. Oktober 2021. Trocken-verplaudert beschreibt der Ich-Erzähler in PeterLichts neuem Roman Ja, okay, aber die Coworking-Welt des dritten Jahrtausends: Callcenteragents, Chiropraktiker:innen, ein Architekt, ein Fotograf. Woran sie arbeiten? Nicht so wichtig. Wichtig ist die Schönheit der mäandernden Sätze.
Von Christian Rakow
27. Oktober 2021. Ja okay, aber die ersten hundert Seiten hätte er sich schon ein wenig sparen können. Und auch in der zweiten Hälfte ist vieles eher so mittel interessant, anderes ein bisschen egal, manches fast etwas ungeil.
Das Schöne an PeterLicht ist, dass seine Mache zum Weiterblödeln einlädt. Sätze wie "Die Gallerttropfen meiner Trägheit versauen meine Aktivbilanz" schreien förmlich danach, dass man sich bei ihnen einstöpselt. Wobei "schreien" dann auch schon wieder nicht ganz richtig ist. PeterLicht ist eher ein Dichter des trockengelegten hipsteresken Plaudertons, den er hinter einem dicken Gazevorhang der Uneigentlichkeit vorführt. Ein wenig sieht man ihn noch immer auf dem Sonnendeck liegen, das er einst besang, und von dort auf die versammelten Unzulänglichkeiten der spätkapitalistischen Selbstoptimierer herabschauen. Also auf uns.
Garstige Sittenbilder
Seit seinem Debüt mit dem "Sonnendeck" hat er die "Lieder vom Ende des Kapitalismus" verfasst und auf weiteren vier Alben das Ausbleiben ebenjenes Endes indie-popmusikalisch verknust. Er hat die Papiertüte, unter der er in den Anfangsjahren auf Fotos sein Gesicht wie überhaupt seine Biographie vor den Massenmedien versteckte, in der blauen Mülltonne entsorgt. 2007 triumphierte PeterLicht – der Feind aller Rechtschreibkorrekturprogramme, weil artistisch zusammengeschrieben – als Romancier beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis mit Auszügen aus seiner alsbald veröffentlichten "Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends". Es folgte ein weiteres Buch, und jetzt also der zweihunderteinunddreißigseitige Roman "Ja okay, aber".
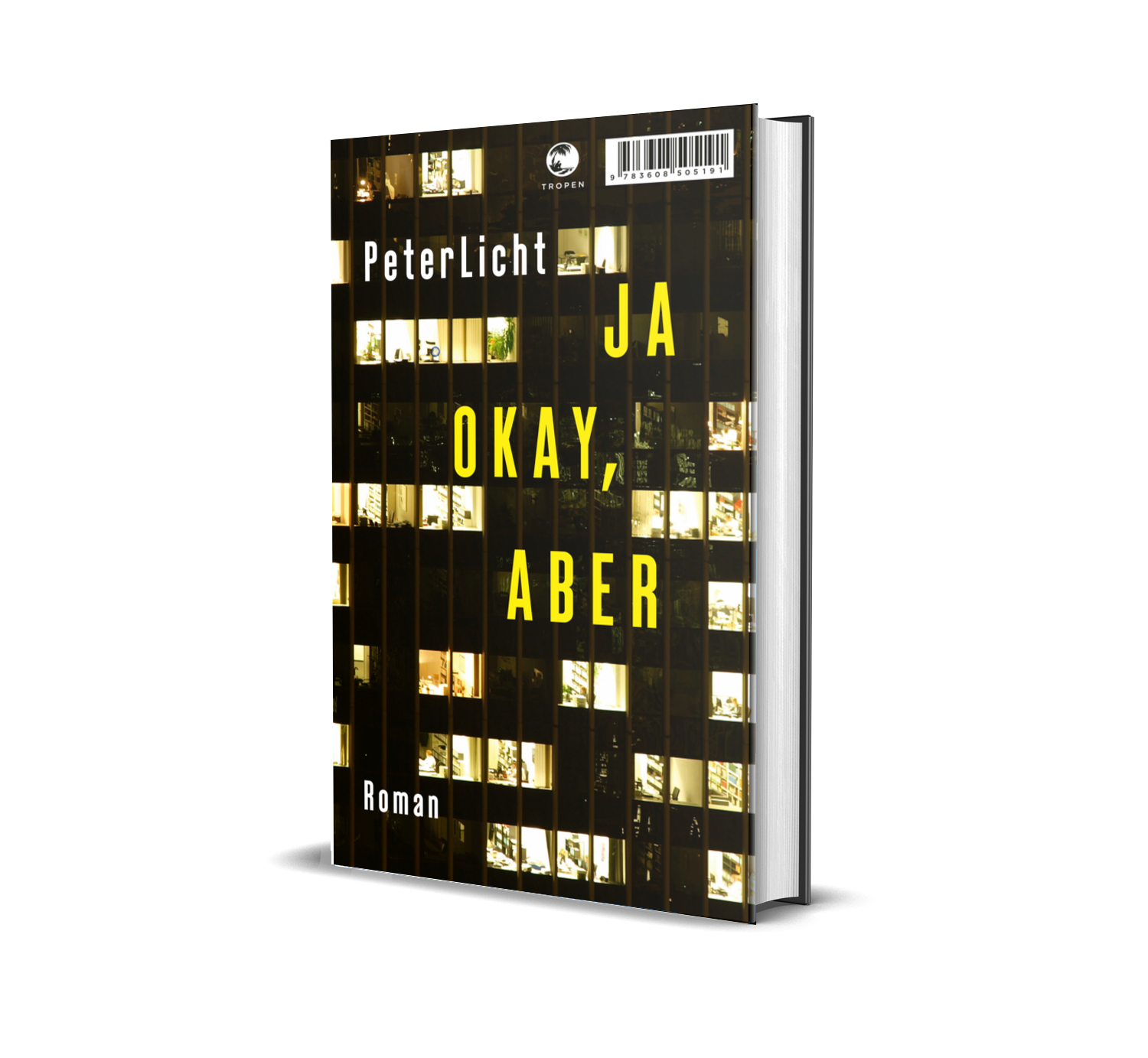 Im Theater, wo er 2009 erstmals aufschlug, ist man von PeterLicht entweder genervt oder begeistert (ich gehöre zu letzterer Gruppe), vor allem wegen seiner Molière-Überschreibungen, in denen er garstige Sittenbilder unserer Zeit zeichnet, stets in penetranten Milieuimitationen, also im schonungslosen Selbstmarketing-Sprech der Bobos und Prekariatsritter von der traurigen Gestalt.
Im Theater, wo er 2009 erstmals aufschlug, ist man von PeterLicht entweder genervt oder begeistert (ich gehöre zu letzterer Gruppe), vor allem wegen seiner Molière-Überschreibungen, in denen er garstige Sittenbilder unserer Zeit zeichnet, stets in penetranten Milieuimitationen, also im schonungslosen Selbstmarketing-Sprech der Bobos und Prekariatsritter von der traurigen Gestalt.
Im Grunde ist das in "Ja okay, aber" natürlich nicht anders. PeterLicht stellt in seinem Roman einen Coworking-Space am Anfang des dritten Jahrtausends vor, erzählt aus der Perspektive eines der Mieter, von dem wir nicht recht erfahren, woran er eigentlich arbeitet. Ist aber auch egal. "Wir alle saugen an der Zitze des Kapitalismus. Manchmal kommt etwas heraus. Davon leben wir", heißt es schon auf der ersten Seite des Buches. Und dann geht's hinein in das diffuse Biotop, dessen Gemeinschaft einzig über den ritualhaften Gang zum Kaffeeautomaten gestiftet wird. "Kein Kapitalismus ohne Kaffee."
Auf einer Schwimmbadrutsche abwärts sausend
Wir lernen zahlreiche anonym vor sich hinwerkelnde Desperados kennen, Callcenteragents, Chiropraktiker, einen Architekten, einen Fotografen, der mal eine Party beim "Infokönig" verpasste und damit seine große Berufschance vermasselte; einen Typ, der Hunde ausführt, einen, "von dem man nicht weiß, was er tut", und allen voran: die Allroundkünstlerin, in die sich der Ich-Erzähler verliebt, wovon allerdings weder sie noch wir so recht etwas mitbekommen. Immerhin spielt er für sie spontan in ihrem neuen Video-Projekt mit und versinnbildlicht auf einer Schwimmbadrutsche abwärts sausend einen "Mann in der Krise“.
Dass weder die Figuren noch was mit ihnen passiert recht plastisch werden, ist natürlich Programm. Mehr als um das Geschehen in dieser Coworking-Welt geht es ums Geschehen im Kopf des Erzählers. Der wirkt wie benebelt vom Zeichensalat der Gegenwart. Mal sinniert er über Sanifair-Autobahntoiletten und wie es dort zum "fairen Austausch von Scheiße und Musik kommt"; mal macht er sich über die kühne Namensgebung bei Frisörläden Gedanken. Was gelegentlich ein wenig angestrengt geistreich wirkt, aber – ja okay – es ist eben auch ein Erzähler, der dem angestrengt geistreichen Milieu entstammt. In einer der vielen selbstreflexiven Volten des Romans sagt er: "Alles könnte passieren, aber es gibt keinen Plot"; "es gibt keinen einzigen Plot, sondern eine unendliche Menge davon". Der Erzähler und mit ihm der Roman stellt sich die Lizenz zum spannungsfreien Mäandern aus.
Grenzgeniale Gedankengirlanden
Während die ersten hundert Seiten mäßig temperiert aus dem Beobachtungs-Alltag des Bobos parlieren, nimmt das Buch ab der Hälfte mit einigen herrlich skurrilen Episoden Fahrt auf. Wir wohnen dem Konzert der "Egalsten der Egalen" bei oder verfolgen den Erzähler und einen Freund beim Versuch, als Elefant verkleidet in eine Bank einzubrechen. Im Finale löst sich dann auch noch das Versprechen von Sanifair ein, und auf einer Party im Coworking-Space wird wahrhaftig aus "Scheiße" erzählerisches Gold gemacht, dem Kapitalismus vor die Open Door gekackt, ein hinreißender schmutziger Ritus inszeniert (nicht unähnlich den Riten, mit denen indigene Völker die Kolonisatoren verhöhnten). Aber wie genau das vor sich geht, muss man bei einem Buch, das Spannung in homöopathischen Dosen verteilt, nun wirklich nicht verraten.
Kurzum, eine glühende Leseempfehlung ist's nicht. Da geht man lieber ins Molière-Theater von PeterLicht und sieht sich an, wie sich Schauspieler in grenzgenialen Gedankengirlanden verknoten. Man kann aber auch sagen: Es ist ja doch ein kurzes Buch, gebt's Euch halt. Die öden Passagen sind nicht so schlimm öde; und die schönen wirklich ganz hübsch.
Ja okay, aber
von PeterLicht
Tropen Verlag 2021, 231 Seiten, 20 Euro
mehr bücher
meldungen >
- 22. April 2024 Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater Weimar
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek



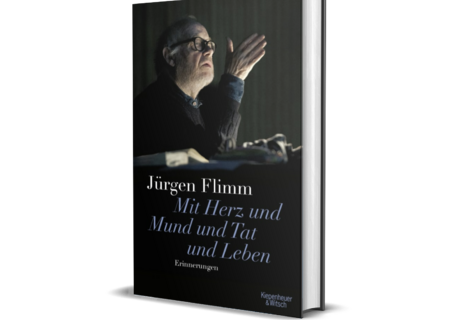









neueste kommentare >