Hildesheimer Thesen XI - Die Zukunft liegt im transkulturellen Theater
Fremdheitserfahrung ohne Exotisierung
von Günther Heeg
Hildesheim, 16. Januar 2013.
These 1
Das deutsche Stadttheater nährt sich vom Phantasma der Nationalkultur
Das deutsche Stadttheater ist ein Mythos. Aber es ist ein Mythos, der sich auch in seiner Verfallsphase immer noch gespenstisch am Leben erhält. Seine Energien bezieht er vom Phantasma der Nationalkultur. Damit ist nicht die Beschränkung auf nationale Themen und Stoffe gemeint. Sondern eine bestimmte Anordnung der einzelnen Theaterelemente Drama, Sprache, Körper, Gestik, Bewegung usw., die einen symbolischen Raum kreieren, der geschlossen und repräsentativ ist und zur Identifikation einlädt. In der Praxis zeigt sich die Wirkung des Phantasmas in der nach wie vor herrschenden Überzeugung, ein Stadttheater habe im Kern die Dramen eines klassischen Kanons auf der Bühne verkörpernd und interpretierend umzusetzen. Damit stellt das Theater ein Szenario imaginärer Gestalten bereit, die sich als Objekte des einfühlenden Begehrens und der affektiven Abgrenzung anbieten. Sie ermöglichen die Trennung von Drinnen und Draußen, Eigenem und Fremdem und bewirken die emotionale Bindung an den symbolischen Raum der vermeintlich eigenen Kultur.
These 2
Die Entwicklung der Stadtgesellschaft zieht dem Phantasma des Stadttheaters den Boden unter den Füßen weg
Das Modell der Marktplatz-Öffentlichkeit, in der das Theater seinen festen Platz hatte, hat sich dezentralisiert und partikularisiert in viele konkurrierende Öffentlichkeiten, die um Anerkennung ringen. Die immer schon scheinhafte Homogenität der bürgerlichen Nationalkultur sieht sich durch die offensichtliche und greifbare kulturelle Hybridisierung, durch Sub- und Parallelkulturen ihres Scheins beraubt. Migrationsbewegungen, transnationaler Kapitalflow und ubiquitäre Medienpräsenz machen die Stadt zu einem Ort des Glocal, der von den Dynamiken der Globalisierung und ihren Bewegungen der De- und Re-Territorialisierung erschüttert wird.
These 3
Die Stadt als Ort des kulturellen Andersseins erzeugt die Angst vor dem Fremden
Bereits 1908 hat der Soziologe Georg Simmel den Fremden als Strukturfigur der modernen Großstadt beschrieben. Zur Stadt heute gehört die Omnipräsenz des kulturellen Andersseins. Aber rivalisierende kulturelle Orientierungsmuster und Praktiken bewirken nicht gleichsam naturwüchsig harmonisches, multikulturelles Zusammenleben. Sie sorgen für Desorientierung und Ängste, die zu Abgrenzung und Exklusionsbestrebungen und der Sehnsucht nach althergebrachten Weisen der kollektiven kulturellen Identifikation führen. Dass sich Theaterleute, Politiker und Zuschauer in dieser Situation an das Phantasma des Stadttheaters klammern, ist Teil der Reaktionsbildungen auf die Verflüssigung der alten städtischen Strukturen und der damit einhergehenden Angst vor dem Fremden.
These 4
Die Begegnung mit dem Fremden verlangt nach einem transkulturellen Theater
Die Begegnung mit dem Fremden rückt das Nahe in die Ferne und lässt uns das Eigene mit fremdem Blick sehen. Dass diese Grunderfahrung des Fremden im Eigenen ihr Potential eines gelingenden Umgangs mit dem Fremden entfalten kann, ist die Herausforderung des Theaters heute. Das Stadttheater, das sich ihr stellt, muss sich als transkulturelles Theater verstehen. Anders als das sogenannte interkulturelle Theater und seine Theorie geht das transkulturelle Theater nicht von abgeschlossenen, distinkten Kulturen aus, die es miteinander in Kontakt zu bringen sucht. Es setzt an der Fremdheitserfahrung im Inneren der kulturellen Phantasmen an, die uns umgeben. Wo auch immer das Theater sich auf die Suche nach dem Fremden macht, bei den Randgruppen und Parallelkulturen, den Armen und den Dropouts der Stadt, bei den Klassikern oder im Apparat des eigenen Hauses, entscheidend ist, dass es das Fremde nicht exotisiert. Dass es sich nicht anmaßt, stellvertretend für andere zu sprechen und sie zu repräsentieren, sondern dass es unsere Wahrnehmung des Fremden verfremdet als Wahrnehmung eines Entzugs und einer Abwesenheit im Eigenen. Deshalb ist es für ein transkulturelles Theater unabdingbar, immer erneut seine Darstellungsmittel zu überdenken und auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer solchen Erfahrung des Fremden hinzu befragen.
These 5
Das Stadttheater geht perspektivisch in einer transkulturellen Theaterlandschaft auf
Das transkulturelle Theater erwächst nicht aus dem Gegensatz zum Stadttheater, sondern durch die Aushöhlung seines Phantasmas. Dies kann von innerhalb und außerhalb geschehen, verstärkt von Grenzgängern, die sowohl mit dem Stadttheater als auch mit anderen Häusern und Produktionsformen vertraut sind. Das unterspült die herausgehobene Position, die das Stadttheater bislang ökonomisch und seinem Anspruch auf Repräsentation nach innehat. Ein Stadttheater als transkulturelles Theater nähert sich den anderen Theaterhäusern der Stadt an. Tendenziell wird es sich von den anderen Theatereinrichtungen nicht mehr grundsätzlich unterscheiden, sondern nur noch graduell durch die jeweilige Akzentsetzung der Häuser. Mit anderen Worten: Das Stadttheater wird sich auflösen, wird Teil unter Teilen, ein Haus unter anderen Häusern der Stadttheaterlandschaft sein. Die Auflösung des Stadttheaters könnte zugleich die Lösung für das städtische Theater sein. Die Voraussetzung dafür ist, dass sich damit auch die bisherige extreme Asymmetrie der ökonomischen Mittel zugunsten einer gerechten Verteilung auf die einzelnen Spielstätten auflöst. Der einzuschlagende Weg ist der des Abbaus von Asymmetrie und Abhängigkeit, des Rückbaus von hierarchischen Strukturen, des Umbaus von Spielstätten und einer wechselseitigen Vernetzung in einer Theaterlandschaft in der Stadt und über deren Grenzen hinaus.
 Günther Heeg ist Professor am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig. Von 1977 bis 1992 unterrichtete er als Lehrer am Spessart-Gymnasium Alzenau, bevor er seine Habilitation an der Universität Frankfurt am Main begann und 2003 schließlich die Professur in Leipzig antrat. Aktuelle Forschungsprojekte sind "Das Transkulturelle Theater" und "Geschichte aufführen – Re-enacting History". Er ist Vizepräsident der International Brecht Society.
Günther Heeg ist Professor am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig. Von 1977 bis 1992 unterrichtete er als Lehrer am Spessart-Gymnasium Alzenau, bevor er seine Habilitation an der Universität Frankfurt am Main begann und 2003 schließlich die Professur in Leipzig antrat. Aktuelle Forschungsprojekte sind "Das Transkulturelle Theater" und "Geschichte aufführen – Re-enacting History". Er ist Vizepräsident der International Brecht Society.
Mehr zur Vorlesungsreihe: www.uni-hildesheim.de
Alle Hildesheimer Thesen sind im Lexikon zu finden.
Siehe auch: die Stadttheaterdebatte auf nachtkritik.de
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.
mehr debatten
meldungen >
- 22. April 2024 Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater Weimar
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024
- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben
- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht
- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek
neueste kommentare >
-
Intendanz Weimar Mathe
-
Intendanz Weimar Anstoß
-
Zauberberg, Weimar Wir sehen nicht
-
Der Besuch der alten Dame, Dresden Große Erwartung
-
Intendanz Weimar Abseits
-
Intendanz Weimar Empathie
-
Besuch der alten Dame, Dresden Blutleer
-
Intendanz Weimar Österreich
-
Medienschau Alexander Scheer Mit Verlaub
-
Deutschlandmärchen, Berlin Sehenswert


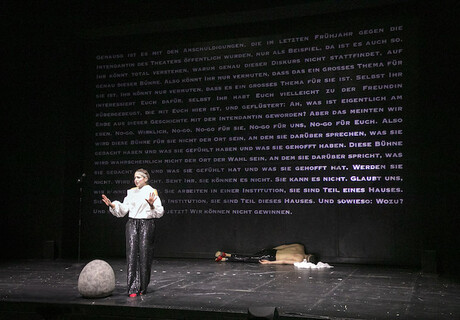



















Sicherlich sind Theaterstücke, die mir Bekanntes aufzeigen und zum erholsamen Genuß einladen, durchaus willkommen, doch profitiert der Rezipient nicht viel mehr durch eine erschütternde Erfahrung des Fremden? Transkulturelles Theater bietet eine kleine Offenbarung in einem gewohnten Raum, dem Theater. Es scheint also die optimale Möglichkeit zu sein, um die Zuschauer zur eigenen Kultivierung und Auseinandersetzung ihrer Selbst anzuregen. Ein künstlerischer Impuls zum Nachdenken, auch nachdem man das Theater verlassen hat.
Und was meinen Sie mit "Kultivierung" des Selbst? Kultivierung, im Sinne von Zivilisation, meint etwas anderes als Kultur, im Sinne von Nationalkultur oder besser sich voneinander unterscheidender kultureller Gruppen.
Schließlich, wie ich es verstanden habe, plädiert Günther Heeg für eine kulturellen Entgrenzung, statt einer milieutypischen Abgrenzung voneinander. Warum soll sich zum Beispiel ein Gefängnisinsasse nicht mit Shakespeare-Dramen beschäftigen können, zum Beispiel? Warum muss er sich stattdessen oftmals immer wieder im Eigenen (Scripted Reality) spiegeln, anstatt sich über das Fremde (Shakespeare oder andere stereotyp "bürgerliche" Texte) selbst anders erproben und erfahren zu können?
Was ich mich aber sofort dabei fragen muss:
Ist dieses Vorhaben realistisch?
Besteht überhaupt auch nur im entferntesten die Möglichkeit dies umzusetzen?
Ich denke nicht, dass das Stadttheater zu diesem Schritt bereit wäre.
Sich mit den anderen Theaterhäusern quasi gleichzusetzen, ein Teil von einer großen Landschaft zu werden, ohne herauszustechen, der Abbau der hierarchischen Strukturen, die gerechte Verteilung der ökonomischen Mittel?
Ich denke nicht, dass dies in nächster Zeit passieren wird.
Auch, wenn es sehr wünschenswert wäre.
Vor allem den Vorschlag eines transkulturellen Theaters kann ich sehr begrüßen. Nur leider muss ich hierbei L. zustimmen, dass dies wahrscheinlich bis auf weiteres eine schöne Utopie bleibt. Die Strukturen sind meiner Ansicht nach größtenteils fast gänzlich unbeweglich, wie in Stein gemeißelt.
Mein persönlicher Höhepunkt in Ihrem Vortrag war der Vergleich des Nationaltheaters mit einem Bildungstempel, in den die Bildungsjünger pilgern. Jedoch bezweifle ich, dass die meisten Theater ihren Bildungsauftrag wirklich noch befolgen. Ich weiß, dass diese Metapher auf die immerwährenden Aufführungen der "alten Schinken", wie "Kabale und Liebe" bezogen waren. Diese Inszenierungen dienen jedoch nicht nur dafür, die Häuser durch Schulklassen zu füllen, sondern ebenfalls, um die Touristen zu befriedigen.
Alle bisherigen Thesen der vergangenen Wochen haben ja auch ein Fazit, dass sich etwas ändern muss. (Eigentlich war das ja auch der Ausgangspunkt der Ringvorlesung.)
Die Frage, die sich stellt ist aber nicht in erster Linie wann sich etwas ändert, sondern wie sich etwas ändern kann. Und diese Veränderungen werden dann wohl in einem langen Prozess von statten gehen. Das deutsche Theatersystem wird sich nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre komplett verändern. Das ist klar. Sondern, so wurde es von Herrn Heeg angedeutet, dass vielleicht in 30 Jahren das deutsche Theater ein transkulturelles Theater ist .
Was mir an Herrn Heegs Vortrag gefallen hat war der Punkt, dass er seine Veränderungsvorschläge von der Stadt aus gedacht hat. Immerhin drehen sich die Ausführungen ja auch um „das Stadttheater“. Deswegen sollten sich Kulturpolitiker auch fragen, was für ein Theater ihre Stadt braucht. Und wie durch das Stadttheater, das für alle Bürger der Stadt gedacht sein sollte, potentiell auch alle angesprochen werden. Dass die obligatorische Klassikerpflege und zwischendurch auch mal junge Dramatik auf der kleinen Bühne des Hauses nur den kleinsten Teil der städtischen Gesellschaft anspricht, zeigen die rückläufigen Zuschauerzahlen.
Vielleicht ändern sich diese Zahlen wieder, wenn das transkulturelle Theater in den deutschen Städten angekommen ist.
Im Gegenteil,sachlich kreisen die Themen derer von Hildesheim um extrem neoliberale Kernbestände des freien Marktes. Der Ausgangspunkt ihres Thesenanschlags (den sie - frei nach Wagner - Ringvorlesung nennen) ist richtig: Es muss sich was ändern am Theatersystem in Deutschland! - Aber was genau, sagen sie nie, nie richtig und nie so richtig ohne Visier! Ist das der berühmte Schleier der Unwissenheit?
Natürlich kann, wie das hier aussieht, auch nach dem Prinzip der Austrocknens der Gemeinden verfahren werden, dem derer von Hildesheim nun daran gelegen ist, neue Werte nach dem Zerfall mit auf den Weg zu geben.
Warum sollte eine Privatuni auch überhaupt solche Debatten losstoßen? - Sehr fragwürdig, ja fast schon nicht hinnehmbar: Da hat die MannFrauschaft jahrelang von den Steuereinnahmen profitiert und profitiert nach der "Bankenkrise" heute erst recht, und stellt sich als Avantgarde hin! Allerdings nicht das erste Mal, das Bürokraten in Deutschland so selbstbewusst auftreten.
Der letzte Schinken aus der Hildesheimer-PR-Maschine war das Interview mit einer STudentin, die ein Deutschlandstipendium bekommt. 150,- € von den 300 kommen von einer pensionierten Lehrerin, mit der sich die Studentin gleich getroffen hat, stundenlang erzählt blabla ... im Stalinismus hätte man der Studentin vom Westen aus vorgeworfen, sie wäre Staatskonform. Wie heisst das heute?
Jedoch: Ist das tatsächlich umetzbar? Erfahrungsgemäß sind die "dicken alten Männer" in den Intendanzen und der Rathäuser zu unflexibel und störrisch, um innovativen Ideen frischen Mutes entgegenzutreten und sie umzusetzen (s. Leipziger Staatstheater). ICh denke, dass die Verantwortloichen, die Einflussreichen, die Umsetzungsfähigen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage sein werden, Eine Veränderung, und geschweige denn eine solch basisverändernde Veränderung wie von Heeg vorgeschlagen, umsetzen können. Das heißt für moich: Der Generationenwechsel in Politik und Intendanz wird noch 20 oder 30 Jahre dauern, bis die Strukturen so für Veränderung aufgeweicht sind, vergehen weitere 20. Heeg war mir da zu optimistisch, indem er für eine vollzogene Veränderung 30 Jahre sieht. Das ist in meinen Augen leider viel zu optimistisch.
und nebenbei- hier müssen nicht nur die Ausführenden lernen und umdenken- sondern eben auch das Publikum. Das bestehende genauso wie das bisher noch unerreichte. Darüber scheinen die Redner in der Reihe der Vorlesung niemals so richtig zu denken. Zuschaueraquise bzw. Forschung dahingehend, was denn das Publikum oder das noch-nicht-Publikum will, scheint absolut kein Thema zu sein. Aber darum geht es doch letztendlich ausschließlich. Theater ohne Publikum? Naja....
Wofür hier argumentiert wird, scheint mir ein neuer Wert des Netzwerkhaften Arbeites à la Steve Jobs in den 80er Jahre, wo du als Künstler aus dem Projekte Schreiben nicht rauskommst.
Was das bringt, Theater in Privathand zu übertragen, zeigt Holland, da sind die Zuschüsse ganz eingestellt worden und rette sich wer kann flüchtet nach drüben!
Was bei Herrn Heeg und Co scheinbar in Echt rauskommt ist ein Abgesang auf die künstlerische Freiheit! - Denn real gibt es längst transnational arbeitende Theater, von der ETC über Prospero bis zur UTE oder dem IETM - alles Erfindungen weitestgehend der 80er Jahre. Darüber sprechen derer von Hildesheimer nicht! Warum nicht? Das könnte dem schwammigen Gerede sich wichtig nehmender C4-Professoren doch auch mal substantielle Konkretheiten, Informiertheit, ja selbst Aussagewert abverlangen!
Ursprünglich stammt die Äußerung von Ai Weiwei.
Auch wenn sich der Gehalt dieser Zitation in diesem kulturpolitischen Zusammenhang plötzlich "verfremdet/überhöht/unsachgemäß" anhören mag, markiert diese Äußerung aber meines Erachtens eine Funktion dieser Online Debatte.
(Diese Debatte innerhalb des Blogs wird öffentlich geführt, deshalb wäre es vorteilhaft Kommentare so zu verfassen, dass sie tendenziell nachvollziehbar sind. Sofern mir selbst das nicht gelingen sollte, bitte ich um Anmerkungen dazu.)
Das Kulturpolitik Institut macht sich durch die Offenlegung ihre Suche nach einer einnehmbare Haltung gegenüber der "größeren" Öffentlichkeit im Bezug auf einen notwendigen Umbau des Theatersystems angreifbar. Zum Glück.
Während den letzten drei Monaten entstanden einige Äußerungen der Kommentatorinnen, in welchen fehlende Wirklichkeitsbezügen der Thesen melancholisch betrauert wurden. Aber diese 1A Vorlage zur melancholischen Kritik eines Vorschlags, mit Hinweiß auf dessen mangelnde Verankerung in der harten Rationalität, bietet sich bei einer Suche (egal wohin) immer.
Genauso wie ineinander greifende Zusammenhänge in der Politik solch einen Umbau wirklich schwierig gestalten, genauso konstituiert jeder Diskussionsbeteiligte diese Zusammenhänge mit.
"Wer sich Gehör verschafft, gerät in Gefahr."
Schlimmer als fehlende Wirklichkeitsbezüge, sind undurchdachte, vorschnelle Vorschläge an eine größere Öffentlichkeit zur Veränderung der Theatersystems.
Schlimmer ist es auch nicht zu realisieren, dass man selbst dazu eine reale Verantwortung trägt.
Egal ob Intendantin, Bloggerin, Studentin, SchauspielschülerinIntendantin oder C4 Professorin.
Danke für die Lesezeit.
Ich kann nicht für die KommentarkollegInnen sprechen, aber für meine Statements und im Interesse des Kritikerwesens kann ich diese Unterstellung zurückweisen, Herr oder Frau M.
Theater im Ballhaus Naunynstraße oder auch die Bürgerbühne des Schauspiels Dresden sind Beispiele dafür, dass Theater ein solcher Ort sein kann und an manchen Stellen bereits ist. Zwar könnte man diese und andere Beispiele mehr als Ausnahmen im Theaterbereich betrachten, denn nach wie vor scheint Transkulturalität im Theaterbereich nicht angekommen zu sein, und partizipative Theaterarbeit zu oft und zu unrecht als Sozialarbeit und Ähnliches abgestempelt zu sein.
Und dennoch zeigen gerade Theater im Ballhaus Naunynstraße sowie andere Ausnahmen aber auch, dass ein Perspektivenwechsel und ein Umdenken in den Theatern durchaus möglich sind!
Dabei finde ich die Idee der Verfremdung des Eigenes relevant, aber auch das Thematisieren bestimmter Sichtweisen, z.B. auch der mitteleuropäischen, weißen auf „das Fremde“. Das heißt z.B. das Offenlegen von möglicher Exotisierung und wie dadurch ein „Wir“ konstituiert wird. Aber kein bloßes Ausstellen und Wiedergeben dieser Exotisierungen, wie auch im Vortrag angesprochen wurde.
Ich denke ein transkulturelles Theater gibt die Möglichkeit Bewusstsein zu schaffen und einer neuen ästhetischen Wahrnehmung.
Und dabei finde ich es wichtig, dass dieses „transkulturelle“ Bewusstsein weiter geht, und zwar bis zu den DeutschlehrerInnen, der Besetzung von Stellen in der Kulturpolitik und bis in andere Ämter.
Hier zum Beispiel, den Ansatz, das Fremde nicht nur in Bezug auf Unterschiede, die sich aus der eigenen nationalen Herkunft bzw. der der Familie ergeben, zu setzen. Darauf wird m.E. in der gesamten Debatte um Interkulturalität oft ein zu großer und damit kulturelle Unterschiede festsetzender und konstruierender Fokus gelegt, als wäre „das Fremde“ per se in migrantischen Milieus zu suchen. Den Begriff des Fremden wieder weiter zu fassen und den Blick auch auf unterschiedliche Parallel- und Subkulturen und Milieus zu legen und zu fragen, wo hier das Eigene im Fremden und das Fremde im Eigenen erfahren werden kann, erscheint mir da sehr viel spannender. Und in Hinblick darauf nach einer gesellschaftlichen Relevanz von Theater zu fragen, hat ja erstmal noch nichts mit Liberalisierung und Marktanpassung zu tun.
Wozu ich mir leider noch kein konkretes Bild machen kann, ist, wie genau nach Vorstellung von Herrn Heeg das Stadttheater strukturell in einer transkulturellen Theaterszene aufgehen kann bzw. wie sich ein solcher Umbau in der Praxis gestalten lässt. In diesem Punkt bleibt der Vortrag meines Erachtens doch sehr vage. Aber gibt Anregung, zum Weiterdenken.
Unabhängig von dem Konzept des transkulturellen Theaters, empfinde ich die These 3 Professor Heegs als etwas sehr zugespitzt.
Außerdem: "Das Stadttheater wird sich auflösen, wird Teil unter Teilen, ein Haus unter anderen Häusern der Stadttheaterlandschaft sein." Soll das heißen die Stadt soll keinen Anteil mehr zahlen? Das "Stadttheater" heißt doch in erster Linie Stadttheater, weil die Stadt einen finanziellen Anteil zahlt, oder?
Der Gedanke des transkulturellen Theaters ist jedoch ein interessanter Gedanke, der weiter ausgearbeitet werden sollte. ("Wo auch immer das Theater sich auf die Suche nach dem Fremden macht, bei den Randgruppen und Parallelkulturen, den Armen und den Dropouts der Stadt, bei den Klassikern oder im Apparat des eigenen Hauses, entscheidend ist, dass es das Fremde nicht exotisiert.")
Mittelfristig sind also auch strukturelle Änderungen in der Theaterlandschaft nötig. Die herausgehobene Stellung, die das Stadttheater bisher, besonders in Bezug auf Subventionen, genießt empfinde ich als zunehmend ungerecht. Wenn sich das Stadttheater als Teil der städtischen Theaterlandschaft begreift, auf welche die zur Verfügung stehenden Mittel gleichmäßiger verteilt werden, kann dies im Optimalfall zu der von Herrn Deeg angesprochenen, wechselseitigen Vernetzung innerhalb der städtischen Theaterlandschaft führen. Die „Auflösung“ des Stadttheaters sehe dabei gar nicht problematisch, bedeutet sie ja nicht gleich die Auflösung des Theaters an sich.
Besonders stellt sich meiner Meinung nach die Frage, wie dieser Wandel zum transkulturellen Theater hin geschehen soll? Es liegt auf der Hand, dass eine so krasse Veränderung der Werte und Normen, die da Fundament des Stadttheaters bilden, nicht von heute auf morgen stattfinden wird. Ist das interkulturelle Theater dann womöglich als eine Art Zwischenstation denkbar?
Immer im Hinterkopf behalten sollte man Ingas Äußerung in Kommentar 2: Auch ich sehe ein transkulturelles Theater als eine kulturelle Entgrenzung. Schade finde ich es, wenn ich Aufführungen sehe, wo mir die jeweilige Kultur wie auf einem Silberteller repräsentativ aufgetischt wird.
Besonders schade finde ich, dass mir mein Kommentar und damit meine Meinung verwehrt wird (siehe Kommentar 8 von Ahas) nur weil ich an dieser Uni studiere. Ich möchte mich mit diesem nämlich nicht profilieren, sondern nur zur thematischen Diskussion etwas beitragen und von anderen lernen!
Wie hoch ist der Anteil des Partizipativen im Stadttheater? Ziemlich gering. Welches Theater frag ernsthaft nach den "Bedürfnissen" der Bürger, der Zuschauer, der Nicht-Zuschauer? Sollte weiter davon ausgegangen werden, dass der_diejenige auf dem Chefsessel weiß, was für die Leute/Bürger/Zuschauer/Nicht-Zuschauer gut ist? Ist es nicht schon ein Zeichen der Bürger, wenn sie die Häuser nicht mehr füllen (wollen)? Was können sie noch für Zeichen setzten, die von den "Obersten" gesehen und angenommen werden?
Keine Frage- es gibt die Bewegung von Stadttheatern zu mehr Transkulturalität- nur wenn z. Bsp. Kooperationen mit dem in der Stadt ansässigen freiem Theater eingegangen werden, doch nicht der Transkulturalität willen, sondern um der Förderung wegen.
"Wer bisher nicht ins Theater geht, lässt sich meiner Meinung nach auch nur schwer durch Änderungen der Inszenierungen für das Theater gewinnen." ("JnBr", Kommentar Nr.19) Richtig, deshalb sollte an diese Menschen herangetreten werden und ihre Relevanz in die Stadttheaterhäuser getragen werden und nicht eine "Exotisierung" derer.
Bleibt doch immer noch die Frage, wie man bis dahin den Rückgang der Zuschauerzahlen verhindern soll. Ich stimme dem Kommentar zu, das wer bis jetzt nicht ins Theater geht wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ins Theater gehen wird. Schulklassen ins Theater zu zwingen und ihnen ihre Schullektüren für die sie sich nicht interessieren auf der Bühne zu zeigen scheint mir da wohl kaum ein weg. Da gefällt mir die Idee eine interkulturellen Theater schon besser, dass sich vielleicht Migrationsproblemen der jungen Menschen auseinandersetzt und neue Ansätze für Schüler aufzeigt.
Die Idee aus den Stadttheatern transkulturelle Theater zu machen ist eine gute und zukunftsweisende Richtung.
Ich frage mich aber auch, ob man das Umsetzen kann?
Sind die Stadttheater zu diesem Schritt bereit sich mit anderen Theaterhäusern gleich zu setzen, ihre hierarchischen Strukturen abzubauen und die Finanzen gerecht zu verteilen?
Ich würde es mir wünschen aber glauben tu noch nicht daran.
Dafür sind die Stadttheater in ihren Strukturen viel zu fest gefahren.
Außerdem frage ich mich, wie das ganze umgesetzt und finanziert werden soll?
Da fehlen mir auch noch konkrete Handlungsempfehlungen.
Die Unterscheidung zwischen interkulturell und transkulturell ist wichtig, um Exotismus vorzubeugen, der allzu oft entsteht, bei Projekten, die es gut meinen…
Wichtig und überfällig finde ich auch die Verabschiedung des Alleinstellungsmerkmals und des Repräsentativ- Gedankens der Stadttheaters. Im Gegensatz zu KIm H. finde ich es jedoch notwendig, diese Ansätze nicht nur als Zukunftsutopie zu denken. Ich frage mich zum Beispiel, wie genau dieses Stadttheater, das dann nur noch eines neben anderen Häusern sein wird, nach der Umverteilung der Gelder, die eine Kürzung bedeuten wird, aussehen könnte, und was vom Stadttheater übrig bleiben wird. Bedeutet dies beispielsweise eine Verabschiedung des Ensemble-Systems?
Auch ich stimme dem Großteil meiner Vorredner zu: Stadttheater "anzugleichen" wäre eine mehr als wünschenswerte Entwicklung. Zwar glaube ich auch noch nicht daran, dass eine solche Entwicklung in naher Zukunft stattfinden kann, doch endlich wird mit Herrn Heeg mal eine Stimme laut, die das Problem der Stadttheater erkennt Lösungsvorschläge bietet. Stadttheater stehen häufig wie ein Fels in der Brandung, halten an ihren oftmals festgefahrenen und stets nach dem gleichen Muster verfahrenden Spielplänen fest.
Es reicht jedoch nicht, den transkulturellen Aspekt nur im Stadttheater durchsetzen zu wollen, diese andere Art von Bewusstsein wäre nämlich nicht nur für das Stadttheater neu. Beispielsweise auch an das Publikum und andere Institutionen muss gedacht werden, Schulen, kulturpolitische Institutinen etc.!