Kolumne: Als ich noch ein Kritiker war - Wolfgang Behrens über Glück und Unglück der Fan-Liebe
Dein ist mein ganzes Herz
von Wolfgang Behrens
5. Januar 2021. Als ich noch ein Zuschauer war, war ich das, was man einen harten Fan nennt. Andere waren unbelehrbare Anhänger von Fußballclubs wie Manchester United, Bayern München oder Westfalia Herne, ich hingegen war ein unbelehrbarer Anhänger des Theaterregisseurs Einar Schleef. Als solcher ging ich natürlich zu allen Heimspielen in meinen damaligen Wohnorten Frankfurt und Berlin – und wie es sich für einen harten Fan gehört, fuhr ich auch, koste es, was es wolle, zu den Auswärtsspielen nach Wien oder Düsseldorf.
Die Reise nach Düsseldorf wäre sogar um ein Haar in einem Desaster geendet, denn meine am allerersten Vorverkaufstag 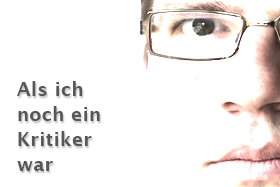 telefonisch reservierte und noch mehrfach mündlich zugesicherte Premierenkarte für Schleefs "Salome"-Inszenierung war an der Abendkasse dann plötzlich doch nicht da. In solchen Situationen schlägt die Stunde des harten Fans: Mein unbedingter Wille war mir wohl derart anzusehen (oder anzuhören, denn das Ganze ging nicht ohne Schreierei ab), dass man mir förmlich einen vorher noch gar nicht existenten Platz aus dem Parkett herausschnitt.
telefonisch reservierte und noch mehrfach mündlich zugesicherte Premierenkarte für Schleefs "Salome"-Inszenierung war an der Abendkasse dann plötzlich doch nicht da. In solchen Situationen schlägt die Stunde des harten Fans: Mein unbedingter Wille war mir wohl derart anzusehen (oder anzuhören, denn das Ganze ging nicht ohne Schreierei ab), dass man mir förmlich einen vorher noch gar nicht existenten Platz aus dem Parkett herausschnitt.
Als harter Fan ließ ich nicht wirklich mit mir diskutieren. Also diskutieren konnte man schon, aber hätte man mich von meinem Fanatismus abbringen wollen, wäre das verlorene Liebesmüh gewesen. Wenn man mich aufforderte, meine zehn Lieblingstheaterinszenierungen zu nennen, lautete meine Gegenfrage: "Mit oder ohne Schleef?" Ich glaube, es war in dieser Zeit nicht schön, mit mir über – sagen wir – Luc-Bondy-Inszenierungen zu sprechen.
"Ganz nett, aber kein Schleef!"
Später, als ich schon ein Kritiker war, tauchte dann allerdings in meinem Bekanntenkreis eine Frau auf, gegen die sich mein Fantum (sprich: Fän-tum) wie eine halbherzige Spielerei ausnahm. Sie war eine harte Fanin (sagt man so?) von Plácido Domingo. Im Grunde machte sie nicht viel anderes als ich, denn wie ich zu Schleef pilgerte auch sie zu jeder erreichbaren Vorstellung, in der ihr Liebling sang. Der Unterschied war freilich der: Wenn Domingo nicht sang, ging sie erst gar nicht hin. Fragte man sie nach anderen Tenören, konnte sie nur abwinken: "Ist nicht Domingo. Kenne ich nicht. Akzeptiere ich nicht." So war ich dann doch nicht drauf: Breth, Peymann, Zadek und Stein wollte ich schon auch sehen. Und sei es nur, um hinterher zu sagen: "Ganz nett, aber kein Schleef!"
Aber jetzt pass' auf: Wenn du ein harter Fan bist, solltest du kein Kritiker werden. Es ist zwar nicht so, dass man als harter Fan seinem Idol völlig unkritisch gegenüberstünde – so sagen zum Beispiel die Fans von Westfalia Herne schon mal ab und an: "Mann, was ist denn das für eine Gurke!" (Und sie meinen damit durchaus nicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft.) Aber als harter Fan ändert sich das Erkenntnisinteresse an allen anderen Erkenntnisgegenständen: Du fragst dich zum Beispiel nicht mehr, wie jemand singt, du fragst nicht einmal, was er anders macht als Domingo, nein, du fragst dich: "Warum singt der nicht wie Domingo?" Was aber nun wirklich keine gute Frage ist, wenn man etwa eine Kritik über Pavarotti, Andrea Bocelli oder Freddie Mercury schreiben möchte.
Falscher Streit ums richtige Legato
Womit ich zu dem komme, worüber ich eigentlich heute schreiben wollte. Vor ein paar Wochen hat es nämlich in der Welt der Kritiker*innen mal tüchtig gerappelt. In der Süddeutschen Zeitung stand da morgens ein Text, der viele Leser*innen ihren Frühstückskaffee verschütten ließ. Ein Kritiker rechnete darin mit dem Pianisten Igor Levit ab, der – um es etwas verkürzt darzustellen – seinen Ruhm und auch sein Bundesverdienstkreuz nicht verdient habe, denn er ziehe die Aufmerksamkeit nur mit wohlfeilem Getwittere gegen rechts auf sich, verfüge aber weder über ein perfektes Legato noch sei sein Klavierspiel überhaupt hinreichend, denn er spiele halt nicht wie Daniil Trifonov.
Der Text wurde, nicht ganz zu Unrecht, skandalisiert, da der Autor Argumentationsmuster benutzte, die antisemitisch lesbar waren – die Publizistin Natascha Strobl hat das auf Twitter brillant herausgearbeitet. Womit ein weiteres Problem in die Welt trat, weil sich der Kritiker nun als Antisemit brandmarken lassen musste, der er sicherlich nicht ist: Jemand, der ausgiebig zu jüdischen Komponisten gearbeitet hat, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden, sollte eines essentiellen Antisemitismus unverdächtig sein. Wie aber können einem erfahrenen Journalisten dann derart fahrlässige Äußerungen entgleiten?
Ich vermute, dass der Hauptfehler des Kritikers darin lag, dass er sich von seiner Fan-Obsession leiten ließ (und ich könnte, wenn ich wollte, gleich noch einige Schreiber*innen mehr nennen, die ihrem Gegenstand etwas zu sehr verfallen sind; ich will aber nicht). Der ganze Text liest sich, als sei hier jemand beleidigt, weil sein Hausgott Trifonov nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie ein anderer Pianist. Und im Trotz sagt er dann: "Ist nicht Trifonov. Akzeptiere ich nicht."
Trostlose Liebe
Die wenigen musikalischen Bemerkungen, die der Autor in seinen Text einfließen lässt, laufen ohne jeglichen Begründungsaufwand auf die Frage hinaus: "Warum spielt der nicht wie Trifonov?" Dass Levit vielleicht eine andere Konzeption des Legatospiels haben könnte, dass seine interpretatorischen Ziele andere sein könnten, das kommt dem Kritiker nicht in den Sinn. Anstatt zu differenzieren wird einfach ein Maßstab behauptet, der von nun an eben nicht mehr zu übertreffen sei. Ende der Diskussion, was erlauben Levit?
Im kritischen Geschäft mag so ein Ansatz von Zeit zu Zeit Erfolg haben, im Grunde aber ist er fatal. Wenn ich nicht das jeweils Eigene der Künstler*innen ausmachen möchte, sondern bei ihnen nur vergeblich dasjenige suche, was andere bereits vermeintlich besser gemacht haben, kann ohnehin niemand vor meinem Urteil bestehen.
Das Leben wird für diese Art von Kritiker*innen übrigens schnell ungemein langweilig und trostlos. Ich spreche da aus Erfahrung. Denn, ob du es glaubst oder nicht, so gut wie bei Schleef ist das Theater halt nie mehr geworden.
Wolfgang Behrens, Jahrgang 1970, ist seit der Spielzeit 2017/18 Dramaturg am Staatstheater Wiesbaden. Zuvor war er Redakteur bei nachtkritik.de. Er studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Mathematik in Berlin. Für seine Kolumne "Als ich noch ein Kritiker war" wühlt er unter anderem in seinem reichen Theateranekdotenschatz.
In seiner vorherigen Kolumne beschäftigte sich Wolfgang Behrens mit kurzsichtigen Machtanalysen im Theater.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.
mehr Kolumnen
neueste kommentare >
-
Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen
-
Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin
-
Orden für Jelinek Ode an El Friede
-
Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung
-
Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken
-
ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!
-
Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig
-
Olivier Awards 2024 Wunsch
-
Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert
-
Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien












Ist übrigens, scheint mir, auch ein Denkfehler, nicht nur von Kritiker*innen, dass man denkt, wahrscheinlich ist das wie bei mir. Ist es nicht.
danke für den Hinweis auf den Alex-Ross-Text von Herrn Maurò, den ich bislang nicht kannte. Nun finde ich persönlich, dass der Text nicht sonderlich gut oder klar geschrieben ist: Wagner-Referat, Ross-Referat und eigener Standpunkt sind nur schwer auseinanderzuhalten. Trotzdem würde mich interessieren, was genau Sie in dem Text als "erschreckend" oder "irre" bezeichenen würden.
Der inkriminierte Text ist hier zu finden: https://www.sueddeutsche.de/kultur/wagner-alex-ross-1.5163167 Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mal am Detail zu diskutieren?