Kolumne: Als ich noch ein Kritiker war – Wolfgang Behrens stöbert in Kollegen-Texten und stellt Fragen
Schamloses Othering
von Wolfgang Behrens
17. November 2020. Als Student habe ich mich einmal über einen Philosophie-Professor aufgeregt, der plötzlich in seiner Vorlesung innehielt, einen seiner Hilfswissenschaftler fixierte und ihn fragte: "Habe ich darüber eigentlich mal publiziert?" Mir kam das damals ungeheuer ungehörig vor, ich hielt es für reine Koketterie, die auf eine möglichst servile Antwort spekulierte (und sie kam auch prompt: "Nein, leider nicht!").
Verblüffende Funde
Heute würde ich längst nicht mehr so streng urteilen: Manche Texte, die ich als Kritiker geschrieben habe, habe ich mittlerweile auch vergessen ("Besser so!", höre ich so manche*n jubeln). Stattdessen erinnere ich mich zum Beispiel an einen Geistesblitz, den ich einmal für einen noch zu schreibenden Artikel hatte, um ein paar Tage später ernüchtert festzustellen, dass der Geistesblitz mich Jahre zuvor schon einmal illuminiert hatte: Ich hatte den Text so im Grunde schon einmal verfasst.
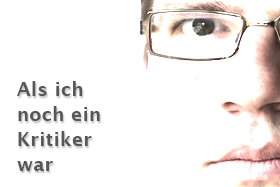 Für den Redakteur, der ich als Kritiker ja auch war, verschärft sich das Problem noch: Die allermeisten der Aberhunderte von Texten, die ich redigiert habe, sind mir nur noch vage im Gedächtnis, manche vielleicht gar nicht mehr (das tatsächlich Vergessene ist schwer zu beziffern, denn man hat es ja vergessen). Interessanter, als dem Entschwundenen nachzuforschen, scheint die Frage: Was ist denn hängengeblieben? Da immerhin stößt man ab und an auf verblüffende Funde, und es fallen einem Texte ein, die irgendwann einmal die eigene Sicht aufs Theater (oder auf die Kunst oder auf die Welt) geklärt, formatiert oder verändert haben.
Für den Redakteur, der ich als Kritiker ja auch war, verschärft sich das Problem noch: Die allermeisten der Aberhunderte von Texten, die ich redigiert habe, sind mir nur noch vage im Gedächtnis, manche vielleicht gar nicht mehr (das tatsächlich Vergessene ist schwer zu beziffern, denn man hat es ja vergessen). Interessanter, als dem Entschwundenen nachzuforschen, scheint die Frage: Was ist denn hängengeblieben? Da immerhin stößt man ab und an auf verblüffende Funde, und es fallen einem Texte ein, die irgendwann einmal die eigene Sicht aufs Theater (oder auf die Kunst oder auf die Welt) geklärt, formatiert oder verändert haben.
Als ich vor zwei Wochen Janis El-Biras Kolumne über Donald Trump als Bühnenfigur las (und darin nicht zuletzt den Satz über "die Ohnmacht eines politischen Theaters, das Abziehbilder des Bösen produziert, anstatt dem schillernden Rätsel seines liebsten Gegners auf den Grund zu gehen"), da schwappte aus der Ursuppe meiner Redakteurszeit ein Text an die Oberfläche meines Bewusstseins, der meinen Blick aufs Theater vor ziemlich genau 15 Jahren tatsächlich deutlich beeinflusst hat. Gelesen und redigiert habe ich ihn für die November 2005-Ausgabe von "Theater der Zeit", geschrieben hat ihn Nikolaus Merck, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachtkritik.de gegründet hatte.
Heruntergelassene Hosen
Unter der Überschrift "Männertheater" konstatierte Nikolaus Merck 2005 ein "epidemisches Phänomen": "Einerlei ob König, Kapitalist oder Kommunist, die deutschsprachigen Bühnen machen den großen Mann lächerlich, entlarven ihn, reduzieren ihn auf krude Gier oder schiere Aufschneiderei." Am liebsten würde ich vor lauter Begeisterung über diesen (vom Autor vielleicht längst vergessenen) Text den ganzen Artikel zitieren, etwa das hier über die "Herrscher von der traurigen Gestalt": "Ihr jeweiliges dramatisches Anliegen in Erwägung zu ziehen, verbietet sich immer schon von selbst. Spätestens nach dem zehnten Satz schlottern ihnen sämtliche Motive lächerlich um die Knöchel wie heruntergelassene Hosen."
Und dann die entscheidenden Sätze, die sich noch heute wie ein Offenbarungseid der gesamten Theaterzunft lesen: "Das Theater macht nicht lächerlich, um zu entmachten; es kann nicht anders. Es hat schlicht die psychische Grundlage verloren, um einen König Lear, den Großkaufmann und Hüttenbesitzer Werle aus Ibsens 'Wildente' oder einen Fabrikanten Dreißiger aus den 'Webern' in ihrer einstigen Pracht, Herrlichkeit und Verblendung darzustellen."
Wohlfeile Selbstbestätigung
Kabumm! Einige Genderdebatten später kann man Mercks Diagnose sicherlich von der Figur des Mannes ablösen und auf diejenige der Macht im Allgemeinen übertragen. Das Skandalon des Befundes indes bleibt, und Janis El-Bira hat es vor zwei Wochen an Donald Trump erneut vorgeführt. Während wir Theatermenschen (nicht zu Unrecht) höchlichst empört sind, wenn ein Trump mit einem einzigen Wort ("They") schamloses Othering betreibt, reagiert das Theater mit seiner eigenen Form des "Othering" und zeigt mit dem Finger auf den Popanz, den man nicht klein und lächerlich genug machen kann, und sagt: "He!" Im schlimmsten Fall kommt man sich dabei auch noch sehr schlau und politisch vor, doch außer wohlfeiler Selbstbestätigung der eigenen Haltung ist da nicht viel Politisches zu sehen. Trump- (oder AfD- oder Was auch-immer-)Wähler*innen wird man so jedenfalls noch nicht einmal im Ansatz erreichen.
Natürlich ist es eine ungeklärte Frage, ob Letztere im Theater überhaupt erreicht werden sollen. Trotzdem sollte das Theater nicht bei der puren Denunziation stehenbleiben, denn diese klärt nichts. Um dem "schillernden Rätsel" der Mächtigen auf den Grund gehen zu können, wird man um die Darstellung ihrer "Pracht, Herrlichkeit und Verblendung" nicht herumkommen. Und um die psychische Grundlage, einen Lear, einen Werle, einen Dreißiger und einen Trump zu spielen, sollte man kämpfen. Ansonsten wird man das Theater als Instrument der Machtanalyse sehr bald einfach nur vergessen können.
Wolfgang Behrens, Jahrgang 1970, ist seit der Spielzeit 2017/18 Dramaturg am Staatstheater Wiesbaden. Zuvor war er Redakteur bei nachtkritik.de. Er studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Mathematik in Berlin. Für seine Kolumne "Als ich noch ein Kritiker war" wühlt er unter anderem in seinem reichen Theateranekdotenschatz.
Zuletzt dachte Wolfgang Behrens über das Verhältnis zwischen Länge einer Aufführung und dem Maß des Kunstgenusses nach.
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.








Wie kommen Sie überhaupt da drauf?
Ich frage, weil ich aus solchen Institutionen in der Regel austrete.
Für mich scheint der erste große Schritt so einfach - welche Information oder Kenntnis fehlt mir? Danke schon mal!
Ohne gleichzeitig bewerten zu wollen, versuche ich mal eine erste, sehr vorläufige Antwort auf die Frage, warum es Intendant*innen noch gibt. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass in den meisten Häusern sehr verschiedene Interessengruppen unterwegs sind (an Mehrspartenhäusern z.B. die verschiedenen Sparten), die wiederum selbst oft durch starke Egos vertreten werden. Wenn nun alle diese Interessengruppen untereinander aushandeln müssen, wer Zugriff auf welche Budgets hat, wer wie in der Disposition berücksichtigt wird etc., dann kommt es oft zu einem Hauen und Stechen (da ja, wie gesagt, starke Egos beteiligt sind), bei dem sich entweder der*die Stärkere durchsetzt oder zeit- und kraftraubender Streit vorprogrammiert ist. Intendant*innen sind im besten Fall so etwas wie Morderator*innen dieses Prozesses und entscheiden dann. Und, ja, durch diese letztliche Entscheidungsbefugnis wächst ihnen eine Macht zu, die auch zu Missbrauch einlädt. Wie gesagt, ich will das hier nicht endgültig bewerten, aber Probleme gibt es sicherlich auch bei Leitungskollektiven.
Ihre Antwort beleidigt fast schon alle Machtdebatten, die es in der Vergangenheit über das Theater gegeben hat. Was sind konkrete Vorschläge, nach den Studien über Macht und Struktur am Theater? Wo ist der (Boykott-)diskurs von den Konsumenten? Ich vermisse auch von der Nachtkritik Lösungsappelle. Wann, wenn nicht in der Coronazeit hätte man Zeit gehabt Lösungen für diese schrecklichen Arbeitsituationen in den Theatern zu finden und konkret Veränderung zu schaffen?
Danke trotzdem für Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihren bedenkenswerten Kommentar. Zu einigen von Ihren Punkten:
"Ein rassistischer, homophober Machthaber wie Trump betreibt tatsächlich Othering, und wer Trump dafür kritisiert, der betreibt dann Herrn Behrens zufolge angeblich auch 'Othering'".
Ich habe unter #3 schon eingeräumt, dass ich den Begriff des "Othering" hier in einem übertragenen, nicht ganz korrekten Sinne gebrauche. Es geht mir aber wirklich nicht darum, Trump-Kritiker pauschal kritisieren zu wollen. Es geht mir darum, sich den politischen Gegner nicht nach Belieben kleinzurechnen. So klein ist er nicht. Wäre er so klein, wäre er wohl auch nicht so verabscheuungswürdig.
"Und die AfD ist nicht an der Macht".
Stimmt!
"Zweitens gibt es keine Wege, 'AfD'ler zu "erreichen', wie der Autor hier schreibt."
Nein, das schreibe ich so nicht. Vielmehr schreibe ich: "Natürlich ist es eine ungeklärte Frage, ob Letztere im Theater überhaupt erreicht werden sollen." Und ich glaube auch nicht, dass Theaterschaffende die Aufgabe hätten, AfD'ler umzuerziehen. Ich glaube aber schon, dass Theaterschaffende sich der Aufgabe stellen könnten, Macht und politische Phänomene wie die AfD in einer gewissen Komplexität darzustellen.
"das Theater als Gesamtheit (als sei es ein Körper, analog zu der Idee des einheitlichen Volkskörpers)"
Und zack! Es gelingt Ihnen mit einer Klammer, mich in die Nähe dumpf-rechten Gedankengutes zu rücken. Ich benutze das Abstraktum "Theater" hier allerdings kaum anders als Sie zum Beispiel den Begriff "heterosexuelle Männer" (als seien diese ein Körper). Das ist solchen Abstrakta nun einmal zueigen, dass sie – abkürzender Verständigung halber – etwas Pauschales an sich haben. Damit soll aber der Raum zur Differenzierung nicht geschlossen werden.
1. Beim Schreiben immer wieder besondere Sorgfalt auf den Gebrauch von Abstrakta zu legen, selbst auf die Gefahr hin, ausführlicher zu werden als man es selbst von sich gern hätte.
2. Raum zur Differenzierung g e b e n als ästhetische wie ethische Aufgabe zu begreifen.