Wo bleibt das Publikum? - Recherche zu einem Thema der Stunde
Ach, diese Zahlen, diese entsetzlichen Zahlen!
22. Juni 2022. Überall ist vom Schwinden des Publikums die Rede. Was sind die Ursachen? Ist die Pandemie daran schuld? Was sagen Expert:innen? Und noch wichtiger: Was sagt das Publikum?
Von Sophie Diesselhorst

Ausschnitt aus dem Filmessay "Publikumsgespräch" von Sophie Diesselhorst | Illustration "Virtuelle Hintergründe" von Julius Burchard
22. Juni 2022. Am 25. April twitterte der Regisseur Christopher Rüping: "Am Samstag haben wir Premiere mit BRÜSTE UND EIER von Mieko Kawakami am Thalia Theater. Tolle Besetzung, phantastischer Stoff. Es wird voraussichtlich die erste Premiere, seit ich Theater mache, die nicht ausverkauft sein wird. Bricht mir das Herz."
Spätestens mit diesem Tweet ist der Publikumsschwund im Theaterbetrieb Thema der Stunde geworden. Und die Facts und Figures der aktuellen Spielzeit, die jetzt aus allen Ecken gemeldet werden, sind tatsächlich alarmierend: Von "geschredderten Zuschauerzahlen" spricht der Schauspielchef des Stadttheaters Bremerhaven Peter Hilton Fliegel in einem Bericht der "Deutschen Bühne", dem Presseorgan des Deutschen Bühnenvereins. Der Oper Frankfurt sind 5000 von 12000 Abonnent:innen abgesprungen. Aus Österreich berichtet die Wiener Tageszeitung "Der Standard", dass sich die Auslastung in den Spielstätten des Burgtheaters in dieser Saison bei etwa 61 Prozent einpendeln dürfte (vor Corona 83 Prozent).
Auch an anderen Wiener Häusern sei sie um mindestens 20 Prozent gesunken, am Schauspielhaus Graz sogar um 30 (auf 62) Prozent. Das Schauspielhaus Zürich, das größte Theater der Schweiz, beobachtet ebenfalls in dieser Spielzeit einen Rückgang der Besucher:innenzahlen. Am schlimmsten hat es allüberall den Boulevard erwischt. Bei der Konferenz "Theater und Netz" berichtete René Heinersdorff, (Mit)Leiter von vier deutschen Privattheatern, von einer postpandemischen Publikums-Reduktion an seinen Häusern um die Hälfte.
Postpandemische Zuspitzung
Die Corona-Pandemie hat viele gesellschaftliche Entwicklungen, die es schon vorher gab, verschärft oder einfach nur sichtbarer gemacht. So eben auch die Tendenz des Theater-Publikums zu verschwinden. Denn auch die gab es schon vorher, ebenso wie die Sorge der Theater um das alte Abo-Publikum und die Sehnsucht nach einem neuen, diverseren Publikum, samt dem damit einhergehenden programmatischen Spagat vieler Stadttheater zwischen Kanon und Diskursformat.
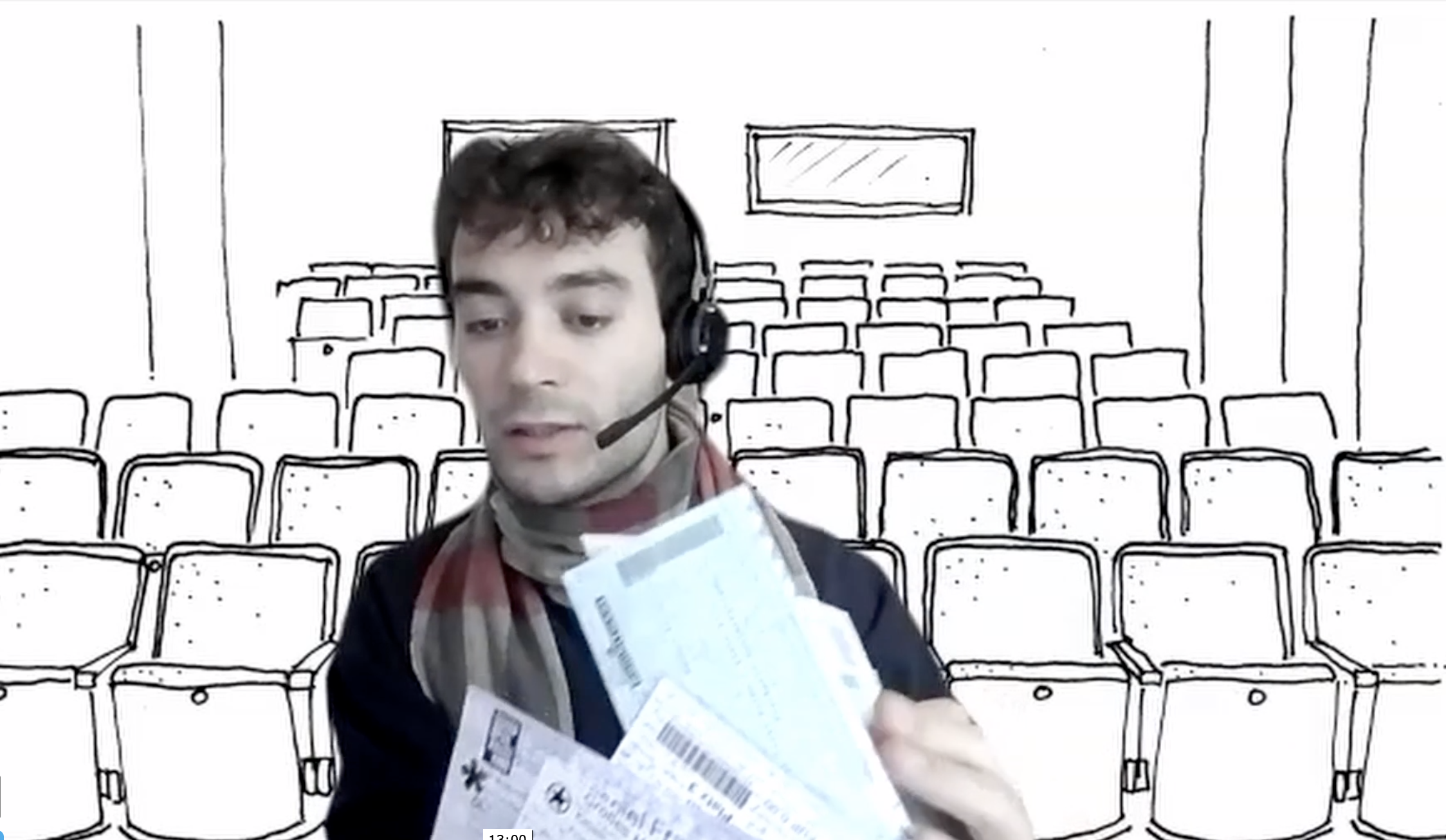 "Ich versuche, möglichst immer meine Theaterkarte aufzubewahren. Ich habe eine extra-Schublade dafür." Zuschauer Leonard aus Wiesbaden. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch" von Sophie Diesselhorst.
"Ich versuche, möglichst immer meine Theaterkarte aufzubewahren. Ich habe eine extra-Schublade dafür." Zuschauer Leonard aus Wiesbaden. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch" von Sophie Diesselhorst.
Neu ist nun die postpandemische Zuspitzung der Lage, die für manche, wenig oder nicht staatlich geförderte Häuser zur existentiellen Bedrohung werden kann. Ebenfalls neu ist dabei die Tatsache, dass offen über den Publikumsschwund gesprochen wird, dass hässliche Zahlen genannt statt geschönt werden. Und dass auf überregionalem Level darüber gesprochen wird, wo "leergespielte" Häuser vor der Pandemie meistens nur im Kontext tendenziöser Lokalberichterstattung über ungeliebte Neu-Intendant:innen vorkamen. Wenn jetzt selbst Kritik- und Publikumsliebling Christopher Rüping das Haus nicht mehr vollmacht, sitzen wirklich alle im selben Boot.
Relevanz stiften
Es mangelt nicht an Expert:innen für das Thema. Erst kurz vorm ersten Corona-Lockdown erschien Anfang 2020 eine Studie, die Birgit Mandel und Moritz Steinhauer vom Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim im Mai und Juni 2019 unternommen hatten. Nur ein Drittel der Bevölkerung ist überhaupt an klassischen Theaterangeboten interessiert – darunter überdurchschnittlich viele Frauen, ältere Menschen, Hochgebildete und Großstadtbewohner:innen, lautete ihr zentrales Ergebnis, das nicht überrascht, wenn man auch nur stichprobenartig auf Theater-Publika schaut und Auslastungszahlen vergleicht.
"Die größten Probleme bestehen in den klassischen Repertoirestrukturen, dem traditionellen Kanon, den traditionellen Produktions- und Rezeptionsformen, den Erwartungshaltungen an Theater und Museum und dem damit verbundenen Image. Ein für neue Zielgruppen attraktives Programm ist der wesentliche Einflussfaktor, um diese als Publikum zu gewinnen", schrieb die Ko-Autorin der Studie Birgit Mandel bereits 2012 im Rahmen der Ringvorlesung 'Hildesheimer Thesen' dazu, "wie Interkulturelles Audience Development Relevanz stiften kann".
Ihre neue Studie ergab nun aber auch, dass 86 Prozent der Bevölkerung trotzdem dafür sind, dass Theater weiter aus öffentlicher Hand gefördert wird. Die Diskrepanz zwischen Ja zu Theaterförderung und Nein zum Theater selbst kann eigentlich nur mit dem Image von Theater als verstaubter Hochkultur-Weihestatt zu tun haben – das Mandel einerseits für dringend reformbedürftig hält und andererseits perpetuiert, wenn sie vehement Veränderungen einfordert, die überall längst im Gange sind.
Können wirklich alle angesprochen werden?
Auch kleine Häuser haben ihre Programme ja längst ausdifferenziert, wie zum Beispiel die allspielzeitlich erscheinenden Theaterstatistiken des Deutschen Bühnenvereins dokumentieren, die in den letzten Jahren einen stetigen Zuwachs der "theaternahen Rahmenveranstaltungen" verzeichneten (für die Spielzeit 2017/18 um fast zehn Prozent!) – und übrigens auch, seit 20 Jahren!, einen stetigen Rückgang der Theater-Abonnent:innen-Zahlen.
Womit wir wieder beim Problem des latenten Publikumsschwunds wären und bei der Frage, wie ein ganzheitlicheres Audience Development funktionieren könnte, wie es zum Beispiel auch der Soziologe Martin Tröndle fordert, Autor der Studie "Nicht-Besucherforschung: Audience Development von Kultureinrichtungen" von 2019.
 "Ich habe immer ein Notizbuch dabei und mache mir Notizen über Dinge, die ich sehe." Zuschauer Alexander aus Berlin. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
"Ich habe immer ein Notizbuch dabei und mache mir Notizen über Dinge, die ich sehe." Zuschauer Alexander aus Berlin. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
Es gehe nicht darum, Barrieren abzubauen, sondern Nähe aufzubauen, schließt Tröndle aus seiner Befragung von Erst-Besucher:innen dreier Berliner Theater. "Es kann inhaltlich-lebensweltliche Nähe sein, die thematisch im Stück angelegt ist, eine Dramaturgie, die überrascht und Momente der Identifikation evoziert, die Architektur der Kultureinrichtung, die Innengestaltung der Räumlichkeiten, die Gestaltung des Aufführungsraumes und seine Atmosphäre, das soziale Gefüge des Publikums und das Gefühl teilzuhaben." Um Nicht- oder Seltenbesucher zu erreichen, müssten Kulturinstitutionen den gesamten Besuch in den Fokus rücken – also: vom Ticketkauf bis zum Nachgetränk.
Außerdem müssten sie sich von der Vorstellung verabschieden, "alle", also "die ganze Stadt" ansprechen zu wollen, so Tröndle. "In einer lebensstilsegmentierten Gesellschaft ist es für Erlebnisanbieter nahezu unmöglich, alle Lebensstiltypen gleichermaßen anzusprechen."
Austausch ermöglichen
Statt "Lebensstiltypen" nutzen die Theater(schaffenden) selbst lieber den identitätspolitisch geprägten Begriff der "Communities", die als Bestandteile einer vormals größer gefassten Stadt-Öffentlichkeit im digitalen Kulturwandel sichtbar und von ihm verstärkt werden. Für Harald Wolff, Dramaturg an den Münchner Kammerspielen, sind sie der Schlüssel zur Ansprache eines neuen Publikums. Wolff glaubt: "Die Theater werden wieder voll sein, aber das Publikum wird sich verändern." Dafür müssten die Häuser sich auf Community Building konzentrieren.
Wie funktioniert das? Harald Wolff sieht "das Anstiften, Organisieren und Inszenieren von Begegnungen" als "große Aufgabe der nächsten fünf bis zehn Jahre". Damit meint er auf künstlerischer Ebene “Formate, die den direkten Austausch ermöglichen, interaktive Formen, kuratierte 1:1-Begegnungen, Spaziergänge, Gaming, Theaterformen jenseits von Repräsentation und Verkörperung.” Auch Vermittlung werde wieder viel mehr ins Zentrum rücken: “Einführungen und Nachgespräche, die Leute anders begrüßen, Codes of Conduct offenlegen, damit Erst-Gänger:innen nicht abgeschreckt sind durch Regeln, die sie nicht kennen.” Tag der offenen Tür, aber jeden Tag.
Kunst, Marketing, Audience Developement
Am Schauspielhaus Zürich ist die gezielte Ansprache des Publikums bereits in vollem Gange. Hier haben Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg seit Antritt ihrer Intendanz drei volle Audience-Development-Stellen geschaffen, die an der Schnittstelle zwischen Kunst und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt sind.
Zwei von ihnen sind Mathis Neuhaus und Laura Rivas Kaufmann; Neuhaus kommt aus dem Musikjournalismus, Kaufmann hat vorher in der Frauenabteilung des FC Zürich die Kommunikation verantwortet. "Es ist ein diffuser Jobtitel, und die Aufgaben unterscheiden sich auch je nach den Kompetenzen, die wir drei mitbringen. Ich kuratiere eine Konzertreihe, bin konzeptionell beteiligt an der Saisonvorschau, die ein wichtiges Instrument der Kommunikation mit dem Publikum ist", beschreibt Mathis Neuhaus seine Arbeit. "Außerdem betreue ich natürlich auch einzelne Produktionen, darunter zum Beispiel die von Trajal Harrell, die sich sehr gut selbst vermitteln – da ist es vor allem wichtig, die kommunikative Basis in Plakaten und Fotoauswahl zu legen; außerdem den Kontakt zu anderen Kunst-Institutionen zu pflegen, deren Publikum ein Interesse an der Kunst von Harrell haben könnte."
 "Ich glaube, dass man im Theater sehr gut zueinander finden kann, sich verstanden fühlen kann vielleicht sogar." Zuschauerin Carlotta aus Berlin. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
"Ich glaube, dass man im Theater sehr gut zueinander finden kann, sich verstanden fühlen kann vielleicht sogar." Zuschauerin Carlotta aus Berlin. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
Das Audience Development geht in Zürich also Hand im Hand mit dem Marketing: Aus der konkreten Erfahrung der Produktionen, die sie begleiten, entwerfen die Audience Developer:innen die jeweilige Werbekampagne und denken dabei zielgruppenorientiert – wobei "Community" hier eben auch so etwas wie "Publikum einer anderen Kunstinstitution" bedeuten kann.
Gigantisches Überangebot
"Ich begreife außerdem die Erschließung des zukünftigen Publikums als Teil meiner Arbeit", sagt Laura Rivas Kaufmann, die schwerpunktmäßig die Produktionen des jungen Programms betreut, was manchmal eine gewisse Flexibilität des Theater-Apparats erfordere. Aber die jungen Spieler:innen dieser Produktionen sind aus ihrer Sicht der Kern des zukünftigen Publikums – deshalb erhielten in dieser Spielzeit alle Mitwirkenden der Jugendclubs am Schauspielhaus ein "Flatrate-U30-Abo", mit dem sie Zugang zu sämtlichen Aufführungen (außer Premieren), eigenen Konzerten sowie Sonderveranstaltungen haben. "Das senkt den Altersdurchschnitt an manchen Abenden schon beträchtlich", sagt Kaufmann.
Die schlechten Besucher:innenzahlen sind derzeit auch bedingt durch ein gigantisches Überangebot, das sich aus dem Rückstau der Lockdown-Zeiten und der Angst vor der nächsten Welle im Herbst ergeben hat. Wenn die nächste Spielzeit losgeht, wird sich zeigen, wie drastisch der Publikumsschwund wirklich ist. Und es wird sich auf die Dauer dann auch zeigen, ob die gezielte Ansprache einzelner Altersgruppen oder Communities die Theater, deren Zuschauerräume meistens noch unter dem Eindruck einer anderen, größeren Idee von Öffentlichkeit konstruiert und vor allem dimensioniert worden sind, füllen kann.
Auslaufmodell Theater-Abo?
Das Theater-Abo, das lange Zeit einen Grundstock an Publikum garantierte, ist schon lange auf dem absteigenden Ast und könnte in der aktuellen Krise endgültig zum Auslaufmodell werden. Es sei "vielleicht nicht mehr der Königsweg", um Zuschauer:innen an sich zu binden, meint Harald Wolff. Stattdessen könnten die Theater über neue Angebote nachdenken wie ein "Buddy-Ticket", mit dem man sich eine:n Mitbesucher:in organisiert. "Niemand geht alleine ins Theater."
Dringlicher als Abo-Reformen und (derzeit sehr beliebte) Rabatt-Aktionen der Theater seien "ein flexibleres Ticketing und vor allem die Möglichkeit, eine Theaterkarte zu stornieren", sagt auch der im Theaterbetrieb einschlägig bekannte Theaterwissenschaftler und Marketing-Spezialist Rainer Glaap, der 15 Jahre lang beim Ticketing-Dienstleister "Eventim" das Produktmarketing für Theater-Ticketing geleitet hat. Gerade in Zeiten von Inflation und pandemisch bedingter anhaltender Planungs-Unsicherheit.
Publikums-Bindung sei wichtig, lasse sich aber ja auch ohne Abo-System herstellen, wie man am Beispiel des Berliner Maxim Gorki-Theaters sehen könne – das seit Shermin Langhoffs Intendanzantritt ein jüngeres Publikum anzieht mit einem höheren Anteil an unberechenbaren Spontan-Besucher:innen.
 "Theater ist der Ausbruch aus meinem Alltag, die Möglichkeit, über andere Dinge nachzudenken." Zuschauerin Astrid aus Wuppertal. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
"Theater ist der Ausbruch aus meinem Alltag, die Möglichkeit, über andere Dinge nachzudenken." Zuschauerin Astrid aus Wuppertal. Screenshot aus dem Filmessay "Publikumsgespräch".
Die Auslastungszahlen sind trotzdem stetig gut, was für Glaap bestätigt, dass es vor allem um "Repräsentanz und Relevanz" geht. Das Gorki-Ensemble ist in seiner Diversität sehr viel näher an der Stadtgesellschaft dran als die meisten anderen Ensembles. Und auch inhaltlich und ästhetisch trifft das Theater einen Nerv im internationalen Berlin.
Werbung versus Word of Mouth
Plakate, Werbung in alten (wie dem Radio) und neuen (sozialen) Medien, all diese althergebrachten Marketingmaßnahmen seien "für die Füße", sagt Rainer Glaap. "Denn was fürs Theater zählt, ist das word of mouth." Das bestätigten auch die Besucherumfragen der Häuser immer wieder. Und persönliche Empfehlungen ergäben sich eben aus der Relevanz des Programms.
"Relevanz" ist nun ein ziemlich schwammiger Begriff. Dazu kommt: Wer sich selbst verordnet, Relevanz zu produzieren, wackelt schnell mit dem moralischen Zeigefinger. Vielleicht muss die Vergabe des Relevanz-Stempels also dem Publikum überlassen werden.
Das Künstlerinnen-Kollektiv She She Pop hat sich seit seiner Gründung intensiv mit interaktiven Formaten und der Einbeziehung des Publikums in seine Arbeit auseinandergesetzt. Im Gespräch darüber beschreibt Mitgründerin Ilia Papatheodorou die Beziehung zum Publikum als "sadomasochistischen Pakt", das She She Pop daraufhin auf verschiedene Weisen immer wieder in ihre Szenarien involvierte, indem sie soziale Szenarien wie zum Beispiel einen Stuhlkreis, ein Lagerfeuer, einen Ballsaal zitierten. "Die Gemeinschaft war also in jedem Stück eine andere, aber das Zuschauen wurde von uns stets definiert, es wurden spezifische Aufgaben damit verbunden", sagt Ilia Papatheodorou.
Was sagt eigentlich das Publikum?
Bevor der Publikumsschwund so richtig in die öffentliche Wahrnehmung rückte, habe ich Ende 2021/Anfang 2022 für meinem Filmessay "Publikumsgespräch" acht Menschen interviewt, die sich als Theater-Zuschauer:innen bezeichnen würden – wobei sie davon ein durchaus unterschiedliches Verständnis haben.
"Ich glaube, gute Kunst und gutes Theater hat seine Kraft aus sich heraus, und das Ausbleiben des Publikums hat weniger mit der Pandemie zu tun als mit dem Theater selbst", sagt Alexander, Gründer einer ursprünglich studentischen Zuschauer:innengruppe in Berlin. Er sagt auch: "Ja, eine gute Website ist toll. Ja, ein pädagogisches Programm und ein Publikumsgespräch ist toll, aber am Ende knallt der Abend oder er knallt nicht, ganz übertrieben." Astrid, Alleine-Gängerin und Theater-Twitterin, hält dagegen: "Verstehe ich das Stück, das auf einer Bühne gespielt wird? Ist es also so einfach, dass es tatsächlich verstanden werden kann. Gibt es eine Einführung, die mir die Handlung schildert oder gibt es zumindest ein Programm, in dem die Handlung kurz beschrieben ist? Das kann etwas sein, was mir wahnsinnig hilft."
Es gibt kein Patentrezept
HerauUnd die Berliner Schülerin Carlotta hängt als Digital Native einer ganz altmodischen Idee von Öffentlichkeit an, dem anonymen Beisammensein jenseits der eigenen Community: "Also, ich habe ja meistens mit den Personen, mit denen ich da in einem Theatersaal sitze, überhaupt nichts zu tun. Das sind ja eigentlich komplett fremde Personen, und die einzige Gemeinsamkeit, die ich dann halt mit denen habe, ist, dass wir zusammen dieses Theaterstück erleben. Und das, finde ich, ist eigentlich auch total schön, dass man halt nichts gemeinsam hat, bis auf dieses eine Theaterstück, was man halt gleichzeitig am gleichen Tag geschaut hat."
Sophie Diesselhorsts Essayfilm "Publikumsgespräch".
Was lässt sich aus diesen Stichproben schließen?
Vielleicht, dass es am allerwichtigsten ist für die Theater, nicht zu denken, dass es ein Patentrezept gibt gegen den Publikumsschwund – sondern das Publikum in all seinen individuellen und Gesamt-Widersprüchen als ernstzunehmendes Gegenüber zu begreifen, das sowohl herausgefordert als auch verstanden werden will. Belehrt werden will es dagegen höchstens im übertragenen Sinn. Dazu noch einmal Zuschauerin Astrid: "Ich glaube tatsächlich, dass wir zu stark in einer Gesellschaft leben, die die Sicherheit als das Ziel schlechthin ansieht. Das merkt man auch an den aktuellen Diskussionen rund um Themen wie Pandemie und wie gehen wir damit um. Ich glaube, dass Menschen den Umgang mit Unsicherheit lernen müssen. Und im Theater kann Unsicherheit ganz anders adressiert werden, weil plötzlich Dinge passieren können, die für mich im Moment nicht vorstellbar sind."
"Es gibt kein neues Publikum. Das alte bleibt weg", sagt Alt-Entertainer Harald Schmidt gewohnt provokationslustig im Interview mit der Berliner Zeitung zur aktuellen Debatte um den Publikumsschwund. "Wenn ich ins Theater gehe, möchte ich möglichst virtuose Schauspieler und ein Stück sehen. Mich interessieren keine Projekte und auch nicht die politische Befindlichkeit eines Ensembles, weil da fehlt den Ensemble-Mitgliedern die Kompetenz. Das funktioniert nur in einem System, wo die Theater mit Milliarden subventioniert werden."
Fuchtel des Spardikats
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Nur in einem System, wo die Theater sich auf staatliche Förderung verlassen können, können sie sich jetzt in bester Tradition der totalen Selbst-Überforderung sowohl ganz auf ihre Kunst als auch ganz auf eine neue Besucher:innenfreundlichkeit konzentrieren und damit nachhaltig aus dem postpandemischen Publikumsschwund lernen. Dafür müssen sie sich allerdings darauf verlassen können, dass ihre Infrastruktur gesichert ist. Das ist die Aufgabe der Kulturpolitik – einer Kulturpolitik, die nach zweieinhalb Jahren mehr oder weniger konzertierter pandemischer Hilfs-Aktionen nun vielerorts unter die Fuchtel des Spardiktats zu geraten droht. (Ausnahmen wie Hamburg oder Wien, wo der Kulturetat unter dem Eindruck der Pandemie vorausschauend erhöht worden ist, bestätigen die Regel.)
Auslastungszahlen können auf die Dauer nicht vor der Politik versteckt werden. Insofern ist es wichtig und gut, wenn die Theater-Community sich jetzt sowohl der wissenschaftlichen und künstlerischen Besucher:innen- als auch Nichtbesucher:innen-Forschung widmet, solange die entscheidenden Weichen noch gestellt werden können.
Sophie Diesselhorst ist Redakteurin bei nachtkritik.de. 2021/2022 hat sie den Essayfilm "Publikumsgespräch" gemacht, in dessen Kontext die zitierten Zuschauer:innen-Interviews enstanden. Die Filmpremiere fand am 30. Juni 2022 um 19 Uhr auf nachtkritik.plus statt und stand im Zentrum einer Veranstaltung, die sich mit dem Thema "Publikum" auseinandersetzte. Nachschaubar hier.
- Weitere Texte zum Thema Publikum und Publikumsschwund auf unserer Themenseite "Publikum".
Wir bieten profunden Theaterjournalismus
Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.
mehr debatten
meldungen >
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier
- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt
neueste kommentare >
-
Intendanz Weimar Inhaltlich sprechen
-
Akins Traum, Köln Unbehagen mit dem Stoff
-
Akins Traum, Köln Historische Weichzeichnung?
-
My Little Antarctica, Berlin Grüße und Glückwunsch
-
Harzer nach Berlin Zunichte gemacht
-
Akins Traum, Köln Autor und sein Stoff
-
Leserkritik P*rn, Berlin
-
Staatsoperette Dresden Frage
-
My Little Antarctica, Berlin Gelungen
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Vielen Dank!






















Was für ein Theater fordert der Präsident der Dramaturgischen Gesellschaft? Eines «... jenseits von Verkörperung und Repräsentation».
Ist es zu fassen? Als würde ein Kapitän zu seiner Mannschaft* sagen: «Leute, Schiffe werden überschätzt. Braucht heutzutage keine*r mehr! Los geht's, stechen wir in See! ... »
Ahoi!
Der Weg aus der Krise führt auch über eine andere Prioritätensetzung:
Bevor Theater politisch gedacht werden kann, muss es zuerst ethisch gedacht werden. Bevor es ethisch gedacht werden kann, muss es zuerst ästhetisch gedacht werden. Bevor Theater ästhetisch gedacht werden kann, muss es zuvor generisch gedacht werden. Aus dem eigenen Herkommen als Kunstform.
Die einen gehen nicht, weil keine Maskenpflicht herrscht. Die anderen gingen nicht wegen der Maskenpflicht.
Mir sind jedenfalls einige ältere Ex-Abonnent:innen persönlich bekannt, die aus Sorge um ihre Gesundheit keine Veranstaltungen mehr besuchen ...
Und die Verprellten suchen sich nun ihrerseits eine Alternative. Die Mitte flieht an den Rand, weil ihr nur dort ein Platz zugewiesen wird. Ebenso tragisch. Man frustriert sich gegenseitig. Und Frustration ist der Feind des Theaters. Man muss dieses Glücksspiel schon mutig betreiben. Es ist ein Werben, ein Gurren, ein Flehen, ein Flirt und eine ganz große Verführung. Man wurde von Pina Bausch verführt, auch weil man sich ganz dringend verführen lassen wollte. Es gab einen echten Bedarf. Ohne diese Alternative wäre man elendig krepiert in einer wirklich öden Stadtgesellschaft. Heute sieht die Situation anders aus. Im Grunde sind ja nun die Visionäre und Innen die eigentlichen SpießerInnen, die einem, ähnlich dem damaligen Kanon, eine Haltung aufzwingen wollen. Da läuft das geschulte Publikum posttraditionell fort und sucht nach Fluchtpunkten an den Rändern. Wieso auch sollte man sich ein neues Welt- und Menschenbild nach dem Muster des Kanons, der Spießer aufdrücken lassen? Wo ist da der verführerische Moment? Weg. Er ist verschwunden. An seine Stelle treten Belehrungen, Demütigungen, ja sogar Ächtung. Wer sein Publikum ächtet und verachtet, verliert es. Mag sein, dass es in Berlin genug Spötter und VerächterInnen gibt, um ein Haus mit vierhundert Plätzen aus der eigenen Community zu füllen. Andernorts sieht es wieder anders aus. Dort ist diese Community der Spötter und Visionäre und Innen einfach nicht groß genug oder sucht sich woanders einen Resonanzboden. Die Peripherie als Mitte ist kein nachhaltiges Projekt, solange sie sich nur behaupten und nicht verführen will. Die Ränder als Setzung funktionieren nur dort, wo ihr eine Mitte entgegen steht, die sich trotzdem verführen lassen will, weil sie mit sich selbst unzufrieden ist. Die heutige Mitte ist aber recht zufrieden mit sich. Sie ist von den Rändern her über ein halbes Jahrhundert in der Mitte angekommen. Endlich. Da braucht es im Theater keinen zweiten Aufguss einer vergangenen Revolution. Das ist dann nur noch Beiklang zu einer so oder so gelungenen Etablierung einer ehemaligen Peripherie, die nun regiert. Claudia Roth war ein Mal Teil von „Ton, Steine, Scherben“. Schon vergessen. Das war ebenfalls in den Siebzigerjahren. Das sie heute aktuell einem starken Vorwurf ausgesetzt, ist Antisemitismus in der Kunst nicht verhindert zu haben, ist wiederum nur eine Randerscheinung dieser Etablierung in der Mitte. Antisemitismus als Marketing ist ein Selbstläufer und funktioniert gerade wunderbar in Kassel. Da könnte sich die Diversität noch eine Scheibe von abschneiden, wenn es nicht so makaber wäre. Diversität ist so gut wie durch. Da kann man nur noch als Nachhut Aufräumarbeiten verrichten. Das Publikum weiß das. Diese multikulturelle Stadtgesellschaft wird so schnell niemand mehr zurückschrauben. Die Theatermacher und Innen wissen das anscheinend nicht. Sie streiten um einen gewonnenen Kampf, dessen Sieg längst in der Mitte angekommen ist. Eine Alternative sieht heute anders aus. Deshalb hat sich aktuell auch eine rechte Gruppe diesen Begriff angeeignet. Eine wahrlich schwere Situation für die Theater. Zu was soll man nun aus der Mitte heraus verführen, wenn man nicht mehr den Charme der Ränder, der Peripherie hat?
Jetzt tauchen auch wieder die Kritiker des "Regie"theaters auf. Regie hat es schon immer gegeben. Eine(r) muss eine Idee haben, den Laden zusammenhalten, die Linie finden, den Duktus...
Und zur Regie-Auffassung: In vielen Bereichen sind heute längst Teams am Werk, wo früher geniale, mitunter autoritäre Einzelgänger das Sagen hatten. Wenn ein Regisseur wie ein Trainer das Beste in einem Team, also einer Mannschaft, fördert und hervortreten lässt, ist das großartig. Für eitle Ego-Trips, wo jemand seine kleine private Meinung über komplexe Meisterwerke zu stülpen versucht, besteht aus meiner Sicht eher keine Notwendigkeit. Und das ist in der Regel für andere, also ein Publikum, auch nicht so interessant. Dass allein die Regie Ideen hat und haben darf, wäre ein wenig lächerlich, das geht vergleichsweise bei Soloausstellungen oder Solistenkonzerten, aber Theater ist dafür ein zu großes und kostenintensives Medium. Da müssen alle Teamplayer sein.
https://www.mediativegedanken.de/2022/06/30/gedanken-zum-publikumsschwund-in-den-theatern/
In unseren Leben werden wir, seit es Internet / Social Media gibt, jeden Tag medial aus allen Kanälen mit den Widrigkeiten / Negativem des Lebens konfrontiert. In Coronazeiten war es kaum noch auszuhalten. Niemand hat sich dem zu viel angenommen. Wir haben die Nachrichten abgeschaltet. Weniger ist mehr. Das wäre der Leitsatz der heutigen Zeit.Theater war für uns eine Welt die auch mit vielen Klassikern aus Oper, Operette, Musical, Schauspiel , Ballett uns ein Stück in eine andere Welt entführen, bezaubern sollte, in die man abtauchen konnte in eine andere Welt/Zeit, in der es auch Widrigkeiten gab, die einen berührten und veranlassten nachzudenken, Dinge zu verändern. Ja, das können wir. Wir das Publikum. Nicht durch ständig neue Interpretationen der Regisseure, nein, wir selbst sind in der Lage „altes“ in heutiges zu übersetzen. Jedoch die sozialkritisch überfrachteten Inszenierungen im heutigen Theater lösen nur noch Widerwillen aus ins Theater zu gehen. Ständige Belehrungen statt Bezauberung. Die Welt der schönen Künste abgedriftet in banales Vorsetzdrama der jeweiligen Regisseure/Darsteller. Bühnenbilder, Kostüme bei denen man sich fragt, wo denn das viele Geld geblieben ist, das als Subvention in die Theaterhäuser fließt. Wir brauchen nicht noch mehr und neuere kostspieligere Theaterhäuser, sondern besseres Theater. Theaterkritiken bei denen man sich fragt, ob der Kritiker anwesend war. Von 10 Bühnenstücken im Schauspiel-Abo, eines das wirklich gut war, der Rest mit Kopfschütteln. Was hinterlässt ein solcher Eindruck? Welches der neuzeitlichen Musicals hat einen Ohrwurm produziert, der dem Publikum wirklich im Gedächtnis ist, wie die aus z.B. My fair Lady? Bei wie vielen erinnert man sich noch nicht einmal an eine Melodie? Oder die Schauspieler? Weshalb bedarf es heute einer Einführung, einer Übersetzung, eines Skriptes aus dem das Publikum ersehen kann, was ihm vorgesetzt wird? Das Publikum als Dümmlinge? Das, was einmal war und gut war, ist vergangen. Ohne die Subventionen hätten wir weniger Theater, was derzeit eher kein Schaden wäre, aber vielleicht wieder Qualität und es Abende an denen man bezaubert und zufrieden und nicht problembehaftet mit den Themen, die uns am nächsten Tag von den anderen Medien erneut erschlagen, nach Hause kommt. Einfach einen schönen Theaterabend zu haben, das fehlt.