Jedermann (stirbt) - Für Stefan Bachmanns Inszenierung an der Wiener Burg hat Ferdinanz Schmalz Hofmannsthals Klassiker einmal ordentlich durchgeschüttelt
Mammon, Meerschwein, Melancholie
von Eva Biringer
23. Februar 2018. Auf der Bühne gähnt ein Schlitz. Sieht aus wie etwas, das mit Bargeld gefüttert werden will oder wie der röhrenartige Eingang zu Onkel Dagoberts Geldspeicher. In einem der stärksten Momente der Inszenierung rotiert diese Röhre um ihre eigene Achse, mitsamt dem Jedermann darin. Erst zwingt sie ihn, auf allen Vieren zu gehen, dann balanciert er sich allmählich in die Vertikale, vom Neandertaler zum Homo oeconomicus. Je mehr die Röhre an Geschwindigkeit zulegt, desto mehr muss sich dieser Jedermann, der ein Männchen ist, abstrampeln, bis er schließlich zusammenbricht. Unter Managern spricht man von Burnout.
Teufel, Gott und Bankenwelt
Gut hundert Jahre zuvor hatten die Leute natürlich andere Probleme. Uraufgeführt wurde Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" 1911 in Berlin. Seit 1920 wird das Stück jedes Jahr mit hochkarätiger Besetzung bei den Salzburger Festspielen inszeniert. Als Auftragswerk für das Burgtheater hat der Autor Ferdinand Schmalz den Klassiker jetzt umgeschrieben oder besser gesagt durchgeschüttelt wie ein Sparschwein. Zwar gehen in "Jedermann (stirbt)" noch immer Gott und der Teufel eine Wette um eine Menschenseele ein, aber zwischendrin geht es um marode Banken, "fickendes Geld" und den Zinseszins. Irgendwie auch um Geflüchtete.
 Sündenfallfreudig: Die (teuflisch) gute Gesellschaft © Georg Soulek / Burgtheater
Sündenfallfreudig: Die (teuflisch) gute Gesellschaft © Georg Soulek / Burgtheater
Schauplatz ist ein (im Text: kein) Garten im Wiener Umland, der sich mit einem Zaun gegen die Außenwelt abschottet, also FPÖ-Österreich und Garten Eden gleichermaßen. Es treten auf: "Die (teuflisch) gute Gesellschaft" in Form des chorisch zischenden Ensembles, das Ganzkörperanzüge trägt und sparkassenrot eingefärbte Zungen. Wie einem Gemälde von Hieronymus Bosch entstiegen spreizt es die Finger zu Teufelshörnern und erfreut sich am Sündenfall. Gott ist bei Oliver Stokowski am Rauschebart zu erkennen.
Holpern in Schmalz' Universum
Markus Hering spielt den Protagonisten als gönnerhaften Big Spender, dessen "Performance", um mal beim Managersprech zu bleiben, im leider unvermeidbaren direkten Vergleich mit den letzten Salzburger Jedermännern (Peter Simonischek, Nicholas Ofczarek, Tobias Moretti) zurückfällt. Gier, Ego, Größenwahn, dazu die meerschweinchenfarbene Perücke und schon wissen alle, wer gemeint ist. Der bescheidene Wunsch einer Theatervielseherin: Bitte eine Quote für Trump-Vergleiche einführen.
Jedermanns Frau wird wenig facettenreich gespielt von Katharina Lorenz, als ein Bunny, das seinem Playboy an Lippen und Hosenbein hängt. Der Vergleich ist auch deswegen angebracht, weil Jedermann stellenweise einen, hoppla, Bademantel trägt. Auch hier wäre hinsichtlich der vielen #MeToo-Querverweise auf deutschsprachigen Bühnen über eine Bademantelquote nachzudenken. Mehr Grandezza hat Barbara Petritsch als Buhlschaft Tod, sehr viel mehr Mavie "Goldmavie" Hörbiger in der Doppelrolle des "Mammons" und der "Guten Werke". Glänzend, wie sie aus dem Dekolleté gepflückte Scheine in die vorderen Reihen wirft. Die Zuschauer greifen danach und geben Szenenapplaus. Auch Markus Meyer und Sebastian Wendelin als Jedermanns Vetter laufen zur Hochform auf, wenn ihre Gesichtszüge beim Anblick von Bargeld holpern wie ein Roulettetisch. Im Gegensatz zu allen anderen Rollen passen sie am ehesten in Schmalz’ Universum, was schade ist.
Wenig Witz mit Hintersinn
Es ist nämlich so: Ferdinand Schmalz gilt zu Recht als große Hoffnung der deutschsprachigen Literatur. Letztes Jahr gewann er den Bachmann-Wettbewerb mit einer schrullig-morbiden Erzählung über einen Tiefkühlwarenlieferanten, der mit dem Selbstmord eines Kunden konfrontiert wird. Sein Autorenvideo drehte er auf dem Friedhof. Anders als viele denkt der 1985 Geborene über den Tod nach, auf eine sehr wienerische Art, obwohl er Grazer ist: kunstvoll, melancholisch, mit leisem, bösem Humor. Sprachkunstvoll ist auch seine Interpretation des "Jedermann", aber doch weitaus weniger bezwingend als andere Theaterstücke, etwa "Dosenfleisch" oder "Der Herzerlfresser".
 Güldener Glanz des Geldes: Olaf Altmanns Bühnenbild © Georg Soulek / Burgtheater
Güldener Glanz des Geldes: Olaf Altmanns Bühnenbild © Georg Soulek / Burgtheater
Noch dazu tut Stefan Bachmanns Inszenierung dem Text in mancherlei Hinsicht keinen Gefallen. Stellenweise werden die reimartigen Sätze stakkatoartig gesungen und von einem Klavier mit Hang zur Dissonanz begleitet (Komposition und musikalische Leitung: Sven Kaiser), was auf ungute Art an Kurt Weill erinnert. Schmalz' ohnehin schon anspruchsvoller Text, übrigens in Gänze im Programmheft abgedruckt, verliert so jede Chance auf Verständnis.
Die Idee der Kostümbildnerin Esther Geremus, alle Darsteller in Goldnuancen zu kleiden, ist schlüssig, aber nicht sehr originell, noch weniger originell, dass sie nach Jedermanns Ableben schwarz tragen. Einem Jackpot gleich kommt Olaf Altmanns Bühnenbild, eine die ganze Bühne erfassende, goldene in-your-face-Wand, mit dem eingangs erwähnten Loch als einzigem Ausweg.
In ihren besten Momenten ähnelt Bachmanns Inszenierung einem Film von Tim Burton, spukig, morbide, dem Tod von der Schippe springend. Oft jedoch verliert sie sich zwischen theatergewordenem Politik- und Wirtschaftsteil einer Tageszeitung, hier die Panama Papers und Bad Banks, dort die Flüchtlingskrise und Trump und alles in allem viel zu wenig von Ferdinand Schmalz' hintersinnigem Witz. Am Ende stirbt Jedermann bleich und nackt wie ein Blankoschein, der Bühnenlochgeldschlitz hat längst aufgehört sich zu drehen. Anders als bei Hofmannsthal ist nicht klar, ob er im Himmel oder in der Hölle gelandet ist. Vielleicht ja auch irgendwo, um seinen Burnout zu therapieren.
Jedermann (stirbt)
von Ferdinand Schmalz (nach Hugo von Hofmannsthal)
Regie: Stefan Bachmann, Bühnenbild: Olaf Altmann, Kostüme: Esther Geremus, Komposition und musikalische Leitung: Sven Kaiser, Choreographie und Körperarbeit: Sabina Perry, Licht: Friedrich Rom, Dramaturgie: Hans Mrak, Livemusik: Sven Kaiser, Béla Fischer.
Mit: Markus Hering, Katharina Lorenz, Elisabeth Augustin, Barbara Petritsch, Markus Meyer, Sebastian Wendelin, Oliver Stokowski, Mavie Hörbiger.
Dauer: 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause
www.burgtheater.at
Kritikenrundschau
Ferdinand Schmalz‘ Könnerschaft besteht darin, dem Original dicht auf den Fersen zu sein, aber sich in einer eigenen, weltlich-unsentimentalen Verssprache die Bigotterie vom Leib zu halten. - derstandard.at/2000074932029/Jetzt-fast-ohne-Gott-jedermann-stirbt-am-Burgtheater
"Ferdinand Schmalz‘ Könnerschaft besteht darin, dem Original dicht auf den Fersen zu sein, aber sich in einer eigenen, weltlich-unsentimentalen Verssprache die Bigotterie vom Leib zu halten", schreibt Margarete Affenzeller im Standard (online 24.2.2018). "Sein neuer Jedermann (Markus Hering) ist ein superreicher Börsenspekulant, der jede Tat und jede Regung als Geschäftsmöglichkeit betrachtet." Seine Rede an den Verbindlichkeitswert des Geldes, an dessen Gottgleichheit und göttlichen Glaubensgrad gehöre zu den erhellendsten Momenten im Kunstfigurenkabinett von Regisseur Stefan Bachmann und seiner formalisiert-märchenhaften Inszenierung.
Christoph Leibolds Beitrag für den Deutschlandfunk steht auf der DLF-Website (24.2.2018): Obwohl in den Dialogen immer wieder ganz "unpoetisch" von "Investment", "Analysten" oder "Kleinanlegern" die Rede sei, handele es sich bei diesem "Jedermann 2.0" keineswegs um eine "platte Aktualisierung". Dagegen stehe schon die Sprache von Ferdinand Schmalz. Sie sei "melodisch und rhythmisiert" weshalb Stefan Bachmann den Text als Partitur nehme und streckenweise als "fulminante Sprechoper" inszeniere. Auch die Bühne von Olaf Altmann sei "ein Pfund", mt ihrem "klaffenden Loch", einem "Höllenschlund", "Hamsterrad"oder auch "ein Geburtskanal", in Bachmann das Ensemble "zu Beginn hineinzwängt, nackt wie die ersten Menschen". Schmalz habe den Jedermann einerseits ins heute fortgeschrieben, andererseits werfe er die Frage nach einem reichen Leben im Hier und Jetzt auf, "das sich nicht primär durch materiellen Wohlstand definiert". Leibold empfiehlt den Hoffmannsthalschen Text des Jedermann für die sommerlichen Festspiele durch den Text von Ferdinand Schmalz zu ersetzen.
"Ein kluges Stück, ein hintergründig’ Spiel haben wir da gesehen, hat Schmalz hier uns gegeben. Könnt’ Salzburg sich entschließen nur, dies 'Sterben eines reichen Mannes' statt Hofmannsthal zur Aufführung zu bringen, was führen wir doch gern ans Salzachufer, auf den Domplatz hin. So aber dürfen wir im Burgtheater, in Donaunäh’, der witzig-schlauen Darbietung uns ganz ergeben und 'Bravo' rufen, bis der letzte Vorhang fällt", jubelt Martin Lhotzky in der FAZ (26.2.2018).
Ferdinand Schmalz variiere Hofmannsthals Knittelverse metaphernreich und wechsele zwischen hohem Ton und Alltagssprache. Er klammere Gott und Teufel nicht aus und mache doch ein eindeutig zeitgenössisches Stück daraus, schreibt Tobias Gerosa in der Neuen Zürcher Zeitung (26.2.2018). "Stefan Bachmanns Uraufführungsinszenierung hält sich nicht sklavisch an die Vorlage und wird ihr doch gerecht." In der Fokussierung auf den quasi oratorischen Charakter und die genaue Körperarbeit schaffe die Inszenierung eine große Konzentration.
"Bisher waren die Stücke von Ferdinand Schmalz meist ein Fall für die Studiobühne; im Burgtheater hat er sich in den vergangenen Spielzeiten vom winzigen Vestibül über Kasino und Akademietheater auf die große Bühne emporgearbeitet", erläutert Wolfgang Kralicek in der Süddeutschen Zeitung (28.2.2018). "Erstaunlich, wie gut seine feinziselierte Sprache sich dort behauptet. Das liegt einerseits daran, dass der Text diesmal direkter, weniger verspielt daherkommt, als man das von Schmalz gewohnt ist, und andererseits an der klaren Form, die der Regisseur Stefan Bachmann in seiner heiter-erschütternden Inszenierung gefunden hat."
Seine Rede an den Verbindlichkeitswert des Geldes, an dessen Gottgleichheit und göttlichen Glaubensgrad gehört zu den erhellendsten Momenten im Kunstfigurenkabinett von Regisseur Stefan Bachmann; Bühnenbildner Olaf Altmann und Kostümbildnerin Esther Geremus haben es in goldene Farben getaucht. - derstandard.at/2000074932029/Jetzt-fast-ohne-Gott-jedermann-stirbt-am-Burgtheater
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.
mehr nachtkritiken
meldungen >
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin
neueste kommentare >
-
Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater
-
Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen
-
RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs
-
RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur
-
Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota


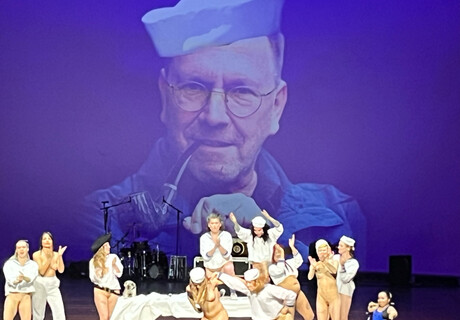



















Die typischen Stilmittel von Ferdinand Schmalz, seine Sprachverliebtheit voller barocker Metaphern, schräger, surrealer Bilder und morbider Komik, treten diesmal in den Hintergrund. Das Auftragswerk oszilliert zwischen zwei sehr verschiedenen Stilen: Die betont artifiziell komponierten Verse imitieren Hofmannsthals Mysterienspiel und ironisieren die weihevolle Atmosphäre des Originals. Uraufführungsregisseur Stefan Bachmann verstärkt diesen Effekt dadurch, dass er einige Textstellen als Oratorium singen lässt. Den Gegenpol bilden die Passagen, die in zeitgenössischer Alltagssprache verfasst sind und die Welt der Hauptfigur mit modernen Begriffen beschreiben. Der „Jedermann 2.0“ ist Börsenspekulant, es wimmelt im Text dementsprechend nur so von Krediten und Zinsen.
Hervorzuheben ist auch das Bühnenbild: Olaf Altmann baute eine bei Bedarf kreisende Röhre, in der „jedermann“ zunächst wie in einer Schaltzentrale thront und auf die weniger Erfolgreichen herabschaut, später aber dann wie im Hamsterrad krabbelt und schließlich im schwarzen Nichts des Todes verschwindet.
Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2018/06/13/jedermann-stirbt-schmalz-burgtheater-wien-kritik/
Und so flimmert der Abend entlang an der Grenze zwischen Konkretheit und Überzeitlichkeit, Distanz und Nähe, altertümlicher Verwunderung und gegenwärtigem Erkennen. Ein Puppenspiel in einer mystischen Ziwischenwelt, die wie doch als die eigene zu erkennen vermögen. Was auch am fantastischen Ensemble liegt: Oliver Stokowski ist ein sanft-melancholischer, trockener Nachbar-Gott, Barbara Petritsch eine schneidend schmeichelnde, selbstbewusste Tod-Buhlschaft, überzeugend und unnachgiebig, Markus Meyer und Sebastian Wendelin farcenhaft dahingezimmerte Geldanbeter, lächerlich und voller Lebenskraft zugleich, Mavie Hörbiger voll satirischer Schärfe und theatraler Verführungskraft als mammon und gute werke, eine Doppelrolle, die hier eigentlich keine ist, weil beide dem selben Zweck dienen.. Lediglich Jedermanns Gattin (Katharina Lorenz) und Mutter (Elisabeth Augustin) bleiben ein wenig eindimensional.
Pathos und Ironie, Ernst und Karikatur gehen Hand in Hand, bald ist dem Zuschauer kaum klar, was hier ernst gemeint und was satirisch gebrochen ist. Gewissheiten verschieben sich, werden unsicher, wie der Boden, auf dem Jedermann irgendwann eben nicht mehr steht. Wie das Loch, das Welt ist und Geldspeicher und Rückzugsort und Nichts, Tod, Auslöschung. Ambivalenzen bestimmen das Geschehen, der Mensch ist nackt, die Darsteller*innen in fleischfarbenen Bodysuits steckend, über die güldene Kostümen gestopft werden, welche die existenzielle Nackt- und Glöeichheit nur weiter betonen. Am Anfang und am Ende stecken sie alle im Lebenshamsterrad, eng gepresst. Jedermann ist tot und vieltausendfach reproduziert. Sie alle sind Jedermann, das System, sein System lässt den Tod nicht zu, erschafft sich immer wieder neu, er stirbt eben nur in Klammern. Ob dieser einzelne in Himmel oder Hölle landet, ist nicht mehr wichtig. Dass das Hamsterrad, der Geldspeicher, das Nichts-Loch gefüllt bleibt, dagegen schon. Da bleibt weder für den Tod noch den Nachbar-Gott noch Platz. Nur für eine Welt voller Jedermänner.
Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2018/06/13/jedermann-lebt/